Der VWL-Schwindel
Was Wirtschaftswissenschaftler so glauben
Man kann sich als Außenstehender das Ausmaß der Dummheit von sogenannten Wirtschaftsexperten kaum vorstellen. Hier ein Zitat aus dem Gutachten zur Rentenreform vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft von 1998:
Im Kapitaldeckungssystem führt die individuelle Sparleistung zu einem Mehrangebot auf den Kapitalmärkten, das sich auf dem Wege über Zinssenkungen in eine zusätzliche Kapitalbildung und wirtschaftliches Wachstum überträgt. Im Umlagesystem wird demgegenüber nur eine Zahlung von den Erwerbstätigen zu den Rentnern bewirkt.
Grundlegende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung Seite 16, Punkt 27
Da wächst der Kapitalstock mit jedem Groschen im Sparschweinderl. Sowas wie Nachfrage, gar Konsumnachfrage, brauche es nicht und wäre voll schädlich, man müsse doch sparen, um den Kapitalmangel zu beheben.
Mit einem solchen Unsinn wurde eine ganze Generation von Rentnern in die Altersarmut getrieben. Das Geld floss dann statt zu unseren Rentnern zu den Finanzkonzernen und auf die Kapitalmärkte, die Professoren wurden zu lukrativen Vorträgen eingeladen und erhielten weitere Forschungsaufträge.
Ein kurzer Verriss der Volkswirtschaftslehre
“I don’t care who writes a nation’s laws – or crafts its advanced treaties – if I can write its economics textbooks.”
Samuelson, 1990, p. ix
Zusammenfassung: Wirtschaftskrisen werden durch die Geldpolitik absichtlich verursacht. Es ist die einzige Aufgabe der VWL, dies zu leugnen und zu vernebeln und Dogmen zur Verschärfung von Krisen zu liefern. Krisen haben zwei Ziele, erstens die lohnabhängigen Arbeiter zu disziplinieren und die Löhne zu senken und die Sozialleistungen und Arbeiterrechte abzubauen, zweitens können die Insider der Geldpolitik mit ihren Informationen in jeder Krise gigantische Profite erzielen und weltbeherrschende Vermögen durch risikolose Spekulation gewinnen. Deswegen ist die Geldpolitik in der VWL (wie im Marxismus) kein Thema. Die Professoren lehren nur Modelle mit neutralem Geld als Tauschmittel (Geldmenge mit Umlaufgeschwindigkeit) und ohne Geldvermögen und Schulden; die Geschichte der Krisen darf nicht behandelt werden; alle Thesen werden durch zirkuläre Argumentation aus den Annahmen der Modelle abgeleitet und die monetären Zusammenhänge kommen in diesen Modellen nicht vor; verwirrende mathematische Formeln sollen wissenschaftliches Arbeiten vortäuschen und die zirkuläre Argumentation verbergen.
Der monetäre Mechanismus der Krisen

Die hohe Effizienz unserer Wirtschaft beruht auf der arbeitsteiligen Produktion. Maschinen und andere Ausrüstung werden optimal eingesetzt und die Spezialisierung ermöglicht die höchste Qualifikation der Arbeitskräfte. Wir müssen uns alle erzeugten Güter gegenseitig abkaufen, weil die Produktion sonst völlig wertlos ist. Krisen haben allein die Ursache, dass wir unsere Leistungen uns gegenseitig nicht mehr abkaufen, weil wir Geld sparen wollen. Anstatt unsere Ersparnisse zu erhöhen, sinken die Einkommen und wir werden nach dem Sparparadoxon von Keynes immer ärmer.
Das Sparen ist die Ursache aller Wirtschaftkrisen, auch der Krise von 1929 bis 1933. Da sind die Menschen auf den Straßen verhungert und hätten doch nur mit dem verdammten Sparen aufhören müssen. Das Sparen war allerdings durch den Goldstandard und die Deflation der Preise verursacht und als ab 1933 mit dem Sparen aufgehört wurde, war die Krise in diesen Ländern schnell vorbei, obwohl manche Regierungen ihr Wirtschaftswunder gar nicht verstanden hatten und nur niemand am Sparen und am Haushaltsausgleich oder Schuldensenken interessiert war.
In einer Ökonomie bestimmen die Ausgaben die Höhe der Einnahmen und die Verschuldung ermöglicht die Höhe der Geldersparnis. Zusätzliches Geldvermögen der Sparer kann immer nur durch zusätzliche Kreditaufnahme der Schuldner entstehen. Die Summe aller Einnahmeüberschüsse, also die Geldersparnis, ist in jedem Zeitraum identisch mit der Summe aller Ausgabenüberschüsse, also der Verschuldung. Das kommt daher, dass an jedem Handel zwei Seiten beteiligt sind, Käufer und Verkäufer. Will jemand mehr einnehmen, als er ausgibt, müssen andere mehr ausgeben, als sie einnehmen.
Die Sparer können zwar planen, aus ihrem Einkommen wesentlich mehr Geld zu sparen, als andere Haushalte sich verschulden wollen, aber diese Pläne lassen sich nicht realisieren. Sie scheitern an der davon ausgelösten Wirtschaftskrise, die das Einkommen der Sparer senkt, so dass die weniger sparen können, und das Einkommen der Schuldner einbrechen lässt, damit die sich unfreiwillig mehr verschulden müssen. Im Ergebnis ist die Geldersparnis immer so hoch wie die Verschuldung, aber das Einkommen kann dabei verheerend wegbrechen, wie etwa 1929 nach dem Börsencrash, als alle sparen wollten, dann wieder 1937 durch den versuchten Haushaltsausgleich in den USA und nach mehreren Jahrzehnten keynesianischer Prosperität wieder 1973/74 und ab 1980 bei mehreren von den Neoliberalen mit Hochzinspolitik inszenierten Krisen.
Das ist der Mechanismus der Krisen. Wollen die Haushalte sich mehr verschulden und weniger sparen, geht das auch nicht, sondern es gibt einen Boom der Konjunktur. Das ist schon der ganze monetäre Konjunkturmechanismus mit Boom und Krisen. Dass die Haushalte mehr sparen und sich weniger verschulden wollen, wird von der Geldpolitik meist durch Hochzinspolitik oder Deflation verursacht. Das Sparen wird mit hohen Realzinsen belohnt und die Verschuldung verteuert, so dass es zur Krise mit den einbrechenden Einkommen der Ökonomie kommt. Die sinkenden Einkommen in einer Krise führen nicht zu einem Gleichgewicht des Gütermarktes, weil die Haushalte geplant hatten, ein höheres Einkommen zu erzielen und mehr zu sparen und sich weniger zu verschulden. Solange die Geldpolitik den Realzins nicht senkt, wird die Krise sich verschärfen.
John Maynard Keynes hat die weiteren Konsequenzen seiner Erkenntnis gut formuliert, was die VWL ihren Studenten bis heute verheimlicht:
“Der Bestand an Kapital und das Niveau der Beschäftigung werden folglich schrumpfen müssen, bis das Gemeinwesen so verarmt ist, dass die Gesamtersparnis Null geworden ist, so dass die positive Ersparnis einiger Individuen oder Gruppen durch die negative Ersparnis anderer ausgeglichen wird”.
“Hence the stock of capital and the level of employment will have to shrink until the community becomes so impoverished that the aggregate of saving has become zero, the positive saving of some individuals or groups being offset by the negative saving of others”.
John Maynard Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money, Chapter 16/III
Der Sinn und Zweck von Wirtschaftskrisen
Absatzkrisen sind das einzige Mittel zur Senkung von Löhnen und Preisen. Absatzkrisen wurden von der Geldpolitik immer absichtlich herbeigeführt, um durch Massenarbeitslosigkeit den Widerstand der lohnabhängigen Arbeiter gegen Lohnkürzung und Sozialabbau und die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen zu brechen. Die Geldpolitik würgt dabei die Güternachfrage mit hohen Zinsen und restriktiver Kreditvergabe ab. Die Massenarbeitslosigkeit zusammen mit der Absatzkrise für Güter sorgen dann für sinkende Löhne und Preise. Eine expansive Geldpolitik kann Krisen wieder beenden.
Zur Zeit des Goldstandards, als die Notenbank zu einem festen Kurs Gold gegen ihre Banknoten herausgeben musste, wurden Krisen regelmäßig erzeugt, um eine boomende Konjunktur mit steigenden Preisen und Importen abzuwürgen, weil durch Importüberschüsse das Gold zu deren Bezahlung ins Ausland floss und so die Goldreserven der Zentralbank gefährdet wurden. Die Notenbanken lösten durch die Erhöhung ihrer Leitzinsen (verheerende) Krisen aus, die Firmen bankrottieren ließen und Millionen lohnabhängige Arbeiter ins Elend stürzten, aber dabei die Löhne und Preise herunter brachen, so dass es wieder zu Exportüberschüssen und damit steigenden Goldreserven kam. Ohne die gezielte Auslösung brutaler Absatzkrisen hätte der Goldstandard überhaupt nicht bestehen können. Absatzkrisen mit restriktiver Kreditpolitik zu inszenieren und durch expansive Kreditpolitik zu beenden, war seit über 200 Jahren die Grundlage der Zentralbankpolitik und die ganze Kunst der Notenbanker.
Die Weltwirtschaftskrise 1929-33 war eine seit 1918 geplante deflationäre Depression, um die Inflation seit 1914 zu korrigieren und den mit der Vollbeschäftigung der Kriegsjahre gewonnenen Lebensstandard der Arbeiter in den USA und GB zu zerstören. Dem Publikum und den Studenten der VWL wurde der Hintergrund dieser Krisen selbstverständlich bis heute nicht verraten. Vor allem deshalb nicht, weil die Krisen noch für andere Zwecke missbraucht wurden, wie etwa die härtere Ausbeutung der Arbeiter und lukrative Spekulationen an der Börse. Jedenfalls glaubt das Publikum noch immer, dass Wirtschaftskrisen ein großes und ungelöstes Rätsel wären, während ein VWL-Professor es natürlich besser wissen und seinen Studenten zuverlässig und systematisch verheimlichen muss, um einen Lehrstuhl zu erhalten.
Lohnsenkung und Sozialabbau und höhere Profite für das Kapital
Die VWL ist für die Wirtschaftskrisen und deren Auswirkungen auf die betroffenen Menschen maßgeblich verantwortlich. Mit ihren Dogmen, die Arbeitslosigkeit sei durch überhöhte Löhne und überzogene Sozialleistungen bei unzureichenden Profiten für das Kapital verursacht und ein Kapitalmangel verhindere die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen und höhere Löhne, hat die VWL jetzt über mehr als drei Jahrzehnte die Umverteilung von Arm nach Reich propagiert und ermöglicht. Sinkende Massenkaufkraft, das Sparen bei Staatsausgaben und die von der VWL propagierte private Vorsorge haben Arbeitsplätze und Kapital durch Unterauslastung vernichtet und Investitionen behindert. Die VWL hat bis heute keine Einsicht gezeigt und lehrt weiter ihren alten Schwindel zur Verschärfung der Ausbeutung der Armen durch die Reichen.
Man lese dazu den von den Professoren Lucke, Straubhaar und Funke initiierten und von insgesamt 243 sogenannten Wirtschaftswissenschaftlern unterzeichneten Hamburger Appell. Jeder Mensch von Geist und mit Restanstand würde sich genieren, unter so ein Pamphlet seinen Namen als Wissenschaftler zu setzen. Das war der Missbrauch akademischer Würden und Titel für durchsichtige Interessenpropaganda.
VWL-Modelle mit angeblich neutralem Geld
Die nach den wirklichen Ursachen der Wirtschaftskrisen fragenden Studenten werden von den VWL-Professoren aufgefordert, sich zuerst einmal mit den Grundlagen der Ökonomie vertraut zu machen, also den an der Uni gelehrten VWL-Modellbau zu studieren. Damit werden die Studenten genarrt, denn die Modelle sind ja eigens so erfunden, dass sie die monetäre Seite der Ökonomie und damit die geldpolitische Verursachung der Krisen gezielt ausblenden. Es sind Modelle mit "neutralem Geld".
Wirtschaftskrisen haben monetäre Ursachen. Um dies zu verschleiern, lehrt die VWL Modelle, in denen das Geld lediglich Tauschmittel ist, also nur Geldmenge mit Umlaufgeschwindigkeit. Dabei sollen die Banknoten und Münzen mit Umlaufgeschwindigkeit keinen Einfluss auf die realen Größen der Ökonomie ausüben, sondern allein die Preise beeinflussen. Dies wird bis heute einfach ganz primitiv und dreist behauptet, wie zum Beispiel im neuesten Lehrbuch von Gregory Mankiw (1):
Wenn die EZB das Geldangebot verdoppelt, verdoppeln sich das Preisniveau, die Nominallöhne und alle anderen in Geldeinheiten ausgedrückten Variablen. Die realen Variablen, wie z.B. Produktion, Arbeitslosigkeit, Reallöhne und Realzinssätze bleiben unverändert. Diese Irrelevanz von Geldmengenänderungen im Hinblick auf reale Variablen wird als Neutralität des Geldes bezeichnet. (S. 795)
Das behaupten allen Ernstes Leute, die unbedingt jede Inflation bekämpfen wollen, weil diese angeblich doch schädlich wäre, obwohl sie selber das Geld für neutral erklären. Denn entweder ist Geld langfristig neutral, dann bräuchten wir uns eben nicht um Inflation zu sorgen, oder es ist eben nicht neutral. Aber logisch denken dürfen Sie in der VWL nicht, sonst fallen Sie durch jede Prüfung. Mankiw kann man fassungslos lesen und sich ärgern, denn der Autor ist nicht irgendein Depp, sondern gilt als führender Wissenschaftler, und seine Lehrbücher sind Vorbild und Prüfungsgrundlage.
Die VWL kennt und diskutiert in ihren Modellen keine Geldvermögen und Schulden. Eine Verdopplung der Preise würde selbstverständlich sämtliche Geldvermögen und Schulden real halbieren und das würde einen gewaltigen Anreiz liefern, sich noch möglichst schnell zu verschulden und seine Ersparnisse an sich entwertenden Geldvermögen für Käufe aufzubrauchen, während die Preise steigen. Das soll keine Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben?
Wir müssen an der Stelle allerdings einräumen, dass in den VWL-Modellen gemäß ihren Voraussetzungen und Annahmen die Ökonomie immer voll ausgelastet ist, so dass eine Belebung der Konjunktur nicht einmal durch Inflation möglich wäre. Weil die Modelle selbst bei einem fallenden Preisniveau keine Unterauslastung kennen, da die Ökonomie angeblich wegen der Profitmaximierung immer voll ausgelastet sein muss, ergibt sich die Neutralität des Geldes halt aus dem Trick der VWL, Geldvermögen und Schulden nicht zu kennen und Änderungen des Preisniveaus weder in Bezug auf die Geldvermögen und Schulden zu diskutieren, noch im Zusammenhang mit der Rentabilität von Investitionen. Bei Deflation haben wir nämlich einen womöglich drastisch erhöhten Realzins, bei Inflation einen womöglich negativen Realzins, aber sogar das IS-LM-Modell kennt einzig den Nominalzins und damit keinen Abbruch der Investition bei noch so schwerer Deflation. Dass bei einem Leitzins der Zentralbank von Null und schwerer Deflation real betrachtet Hochzinspolitik herrscht und sowohl die Investitionstätigkeit abwürgt wie den Konsum dämpft, diese Einsicht kann einen Professor der VWL geistig gar nicht erreichen. Für ihn ist die Ökonomie immer voll ausgelastet und schafft Einkommen genau in der Höhe der Produktion, so dass dieses Einkommen gar nicht anders verwendet werden kann, als für Konsum oder Investition, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, so dass die Produktion immer restlos verkauft werden kann und muss - ein Zirkelschluss: Y = C + I
Den Beweis für den von Mankiw behaupteten Unsinn liefert dann noch sein Schaubild (S. 793), auf dem einfach mit drei Kurven dargestellt ist, wie ein Anstieg der Geldmenge nur die Kaufkraft der Geldeinheit senke. Dazu wird noch Milton Friedman mit seinem "Inflation ist immer und überall ein monetäres Problem" zitiert. Warum man sich überhaupt um die Inflation sorgen sollte, wenn Geld angeblich keine realen Auswirkungen habe, wird ohne nähere Angaben zum Problem der richtigen "Geldmengensteuerung" mit den Auswirkungen der Inflation in der Weimarer Republik (S. 787) und Simbabwe (S. 788) begründet.
Die Neutralität des Geldes ist die Voraussetzung für ein allgemeines Gleichgewicht der Teilmärkte einer Ökonomie. In der Realität gibt es jedoch kein neutrales Geld und daher auch kein Gleichgewicht der Märkte. Die Preise werden nicht durch Banknoten und Münzen mit eingebauter Umlaufgeschwindigkeit gesteuert, sondern durch Boom und Krise, ausgelöst von der Geld- und Finanzpolitik. Die Notenbank erhöht den Leitzins und senkt ihn wieder, nicht der Markt.
Das die menschliche Intelligenz beleidigende Geschwätz von einer langfristigen Neutralität des Geldes finden wir auch bei der Europäischen Zentralbank. Auch diese will unbedingt die Inflation bekämpfen, obwohl angeblich "a change in the quantity of money" gar keinen Einfluss auf "real variables such as real output or unemployment" hätte:
It is widely agreed that in the long run – after all adjustments in the economy have worked through – a change in the quantity of money in the economy will be reflected in a change in the general level of prices. But it will not induce permanent changes in real variables such as real output or unemployment.
This general principle, referred to as "the long-run neutrality of money", underlies all standard macroeconomic thinking. Real income or the level of employment are, in the long term, essentially determined by real factors, such as technology, population growth or the preferences of economic agents.
Nach allen verheerenden politischen und ökonomischen Folgen der mit restriktiver Geldpolitik absichtlich inszenierten Weltwirtschaftskrise 1929-33 behaupten diese Figuren immer noch die langfristige Neutralität des Geldes, dass die Weltwirtschaftskrise also keine langfristigen Verheerungen zur Folge gehabt hätte. Dass diese korrupte Denke allem "standard macroenonomic thinking" zugrunde liegt, ist ja eben das Problem mit den Krisen bis heute. Und diese falschen Dogmen finden tatsächlich bis heute weite Zustimmung, darauf können sich die Figuren der EZB berufen. Genau das muss sich ändern.
(1) Mankiw/Taylor: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2012
Die Multiplikatoranalyse mit einem VWL-Körnermarkt ohne Geld
Der Multiplikator und das Sparparadoxon von Keynes widerlegen die angebliche Neutralität des Geldes. Die VWL-Professoren mussten sich ein Modell konstruieren, in dem der Multiplikator und das Sparparadoxon sogar ohne Geld vorkommen, womit die Neutralität des Geldes wieder bewiesen wäre. Natürlich nur durch einen Trick, den uns hier der Prof. Dr. Michael Berlemann von der Universität der Bundeswehr in Hamburg stellvertretend für seine Kollegen vorführt: Modul Makrookonomik (WS13V02.1/WS13V02.2) (PDF)
Auf Seite 37 beginnt mit 3.1 die Modellbeschreibung seines Kornmodells ohne Geld. Auf der Seite 42 wird ganz harmlos ausgeführt:
Im einfachen Gutermarktmodellmodell gehen wir zunachst von einer exogen bestimmten Investitionsnachfrage der Unternehmen aus.
Soso, die Bauern produzieren also Korn für den Konsum und die Investitionen. Als Konsumenten wollen sie mehr sparen und ihre Konsumquote zu diesem Zweck senken. Wegen der kleinen und ganz unscheinbaren Einschränkung des Modells auf exogen bestimmte Investitionen ist aber keine Erhöhung dieser und damit der Ersparnisse möglich. Die Bauern essen weniger von ihrem Korn, dabei bleiben aber nicht mehr Körner zur Investition übrig, weil die Annahmen des Modells diesen Fall ganz nebenbei ausgeschlossen haben. Also führt eine Erhöhung der Sparquote nicht zu einer höheren Ersparnis, sondern zu einer sinkenden Körnerernte: Das Sparparadoxon in einer Ökonomie ohne Geld!
Aber eben nur mit der völlig unbegründeten Annahme, dass die Investition exogen bestimmt wäre. Ein Trick, denn das ist ja nur in einer Ökonomie mit Geld der Fall, weil sich für höhere Geldersparnisse der privaten Haushalte die Unternehmen oder der Staat oder das Ausland höher verschulden müssten. Den Studenten wird der Trick nicht erklärt und sie haben die unscheinbare Annahme exogen bestimmter Investitionen kaum bemerkt und glauben jetzt, dass Sparparadoxon und Multiplikator auch in einem Körnermarkt ohne Geld wirken würden und somit das Geld gar keinen Einfluss haben könne und neutral sei, wie die Professoren es immer wieder behaupten.
Verwirrspiele um den Multiplikator von Keynes
Eigentlich ist der Multiplikator nach Keynes ganz einfach zu verstehen:
In der makroökonomischen Betrachtung ist die Höhe der Ersparnisse den privaten Haushalten vorgegeben. Die Gesamtwirtschaft kann nur durch eine Erhöhung ihres Kapitalstocks sparen, also durch die Nettoinvestition. Für die privaten Haushalte ist zusätzlich noch das Sparen von Geld möglich, aber nur in dem Umfang, in dem andere private Haushalte Kredite aufnehmen oder ihre Ersparnis durch Konsum abbauen (der in der VWL sogenannte autonome Konsum) und der Staat oder die Unternehmen und das Ausland sich zusätzlich verschulden.
Wollen die Haushalte jedoch durch Konsumverzicht mehr sparen, senken sie nur das Einkommen der Ökonomie: Y = C + S
Wenn die Haushalte weniger sparen wollen, steigern sie bei dem Versuch nur ihr Einkommen. Das ist das von Keynes beschriebene Sparparadoxon.
Haben wir die von den Haushalten gewünschte Sparquote, dann ergibt sich das Einkommen der Ökonomie aus dem Produkt der durch die obige Formel vorgegebenen Ersparnis mit dem von Keynes erläuterten Multiplikator, dem Kehrwert der Sparquote. Wenn zum Beispiel der Staat sein Defizit um 100 Mrd. Geld erhöht und die Sparquote beträgt 20%, dann kann das Einkommen der Ökonomie um 500 Mrd. Geld steigen, von dem die privaten Haushalte bei einer Sparquote von 20% genau die 100 Mrd. Geld sparen können, um die sich der Staat zusätzlich verschuldet hat. Darum soll und kann eine Krise nach Keynes durch ein Deficit Spending des Staates überwunden werden.
Das dürfte jeder leicht verstehen, würde es von der VWL so kurz und knapp erklärt. Die VWL lehrt jedoch keinen Multiplikator für die Ersparnis, sondern einen Ausgabenmultiplikator. Der dient der Verwirrung der Studenten, weil der Zusammenhang des Einkommens mit der Ersparnis vernebelt wird. Man besehe sich dazu nur die VWL-Lehrbücher.
Das ganze VWL-Verwirrspiel am Beispiel des VWL-Gütermarktes

Rechts sehen Sie die Grafik der VWL für ein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt. Schauen Sie sich das in Ruhe an und fragen Sie sich, was das soll:
Das Einkommen einer Ökonomie wird durch die Produktion bestimmt und ist mit dieser identisch (im Modell gibt es kein Ausland, sondern nur unsere Makroökonomie, es kann also nichts importiert oder exportiert werden).
Um die Studenten zu verwirren, konstruiert die VWL ein Diagramm, in dem zwischen Nachfrage, Produktion und Einkommen unterschieden werden soll, indem die auf verschiedenen Achsen und Linien liegen: Auf der Y-Achse haben wir das Einkommen, auf der X-Achse die Nachfrage, die Produktion liegt dann genau auf der 45 Grad-Linie zwischen den Achsen, was ja auch gar nicht anders sein kann, wenn Produktion, Einkommen und Nachfrage tautologisch identisch sind.
Das Diagramm ist also völlig überflüssig und man könnte Produktion, Einkommen und Nachfrage auch gleich auf die Y-Achse zeichnen, weil die an keinem Punkt voneinander abweichen können.
Vor allem haben wir wieder einmal eine Identität als angebliche Gleichgewichtsbedingung. Das ist in der Grafik daran erkennbar, dass es gar kein Ungleichgewicht geben kann, weil nur Punkte auf der 45-Grad-Achse (Y,Y) möglich sind.
Damit wäre aber die Geschichte vom Gütermarktgleichgewicht erledigt und die VWL müsste zugeben, dass sie zur Bestimmung des Einkommens Y (= Produktion = Nachfrage) der Ökonomie monetäre Zusammenhänge zu betrachten hat, womit das Geld eben nicht neutral sein kann.
In der nachfolgenden Grafik sind auf der Y-Achse das Einkommen der Ökonomie mit der Produktion und der Nachfrage identisch:

In der Grafik rechts wird sofort deutlich, dass sich der Multiplikator nach Keynes auf die Neuverschuldung der anderen Haushalte beziehen muss, die mit ihrer Verschuldung das Geldsparen ermöglichen. Entsprechend hoch fällt der Multiplikator aus, mit dem das steigende oder fallende Einkommen der Ökonomie aus der steigenden oder sinkenden Bereitschaft der Privaten oder des Staates zur Neuverschuldung resultiert.
Im Gütermarktmodell der VWL haben die Professoren den Multiplikator jedoch nicht auf die Neuverschuldung bezogen, sondern sie vernebeln die Zusammenhänge mit einem Ausgabenmultiplikator, der von der marginalen Konsumquote abhängig sein soll:

Jetzt müsste der Student erst von selber auf die Idee kommen, dass das Geldsparen übrig bleibt, wenn man vom Einkommen der Haushalte den Konsum und die von der VWL für ihr Gütermarktgleichgewicht als fix angenommene reale Investition I und dann noch die Steuern T abzieht. In der Gütermarktformel der VWL erhalten wir so zuletzt auch die Differenz von G - T als den in Wahrheit maßgeblichen Zusammenhang:
Das Staatsdefizit ermöglicht den Saldo des Geldsparens der Privaten und der auf das Staatsdefizit bezogene Multiplikator ist der Kehrwert der privaten Geldsparquote.
Aber das kann kein Student verstehen, der mit dem VWL-Gütermarkt verwirrt wurde, bei dem der Multiplikator aus der marginalen Konsumquote resultieren soll. Genau das wollen die Professoren damit auch erreichen.
Die Märkte streben nicht zu einem Gleichgewicht
Der VWL-Modellbau lehrt, dass die Märkte von selbst zu einem allgemeinen Gleichgewicht streben würden, in dem die Produktionsfaktoren optimal kombiniert wären und der Nutzen maximiert würde. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall: Die Teilmärkte einer Ökonomie streben nicht zu einem gemeinsamen Gleichgewicht, sondern durch die am Markt stattfindenden Anpassungsprozesse von einem für die Wirtschaft optimalen Zustand der Teilmärkte immer weiter weg. Die Ursache ist das Geld als Kredit, Schulden und Geldvermögen, wodurch es zu einer prozyklischen Wirkung der Marktkräfte kommt. In den Modellen der VWL fehlt allerdings das Geldvermögen als Geldanlage und Konkurrenz zur realen Investition, vor allem bei Deflation, und ebenso fehlt die Verschuldung, die bei Inflation immer leichter wird und bei Deflation immer drückender: Das haben die Professoren einfach weggelassen, weil Geldvermögen und Schulden die Märkte prozyklisch aus dem Gleichgewicht bringen, und bewundern sich vermutlich für diesen Trick, auf dem das ganze Allgemeine Gleichgewichtsmodell beruht, das sie ihren Studenten lehren.
Sinkende Löhne und Preise verschärfen eine deflationäre Depression, also die Unterauslastung des Produktionspotentials mit Massenerwerbslosigkeit. Das Geldvermögen der Rentiers wird dabei immer wertvoller und eine Verschuldung immer drückender, wodurch sich die Depression vertieft. Die Deflation erhöht den Realzins und würgt daher die Kreditaufnahme zum Zweck von Konsum und Investition immer noch mehr ab. Umgekehrt treiben steigende Preise und Löhne eine inflationstreibende Überauslastung der Ökonomie immer weiter bis zum Zusammenbruch in der Hyperinflation. Eine Inflation senkt den Realzins noch tiefer und belohnt damit die Verschuldung. Eine reale Ökonomie mit echtem Geld strebt im Gegensatz zu den irreführenden VWL-Modellen nicht zu einem Gleichgewicht, sondern die Marktkräfte verschärfen jede Abweichung vom optimalen Pfad, bis die Geldpolitik gezielt dagegen steuert.
Das angebliche Gütermarktgleichgewicht
Als Beispiel für einen ganz typischen Betrug werde ich aus dem Lehrbuch Makroökonomie, 5. Auflage, von Olivier Blanchard und Gerhard Illing, München 2009, Kapitel 3 zitieren. Es geht in dem Kapitel um das angebliche Gleichgewicht am Gütermarkt, das die Autoren aber mit Hilfe einer Identität diskutieren. Sie diskutieren einen tautologischen Zusammenhang als Bedingung für das Gleichgewicht des Gütermarktes.
Der Trick besteht darin, den tautologischen Zusammenhang von Ersparnis und Investition auf eine ganz verdrehte Art und Weise zu diskutieren, so dass der Student vor lauter Kurven über der Y-Achse die Tautologie nicht mehr sieht. Die grafische Analyse finden Sie hier bei Wikipedia zum Thema Gütermarktgleichgewicht, sie ist genau nach dem zitierten Buch gestaltet:
Was da völlig verdreht dargestellt wird, kann ich Ihnen in wenigen Worten erklären:
Produktion und Einkommen einer Ökonomie sind abhängig von der möglichen Ersparnis. Denn die Haushalte wollen mehr sparen, wenn sie ein höheres Einkommen erzielen. Es gilt also Y = f(S). Die Höhe der Ersparnis kann von den Haushalten nicht direkt bestimmt werden, sondern sie ist genau die Summe aus der Nettoinvestition der Unternehmen und dem Defizit Spending des Staates, also dem Staatsdefizit: S = I + (G - T) mit G: Staatsausgaben T: Steuern (G - T): Staatsdefizit
Es ist nicht so, dass die Autoren Blanchard/Illing die Zusammenhänge nicht genau kennen würden:
Gleichung (3.8) besagt, dass die Regierung durch geeignete Wahl von Staatsausgaben G oder Steuern T jedes gewünschte Produktionsniveau realisieren kann.
Makroökonomie, Blanchard/Illing, München 2009, S. 105.
Die Regierung kann also durch ein höheres Staatsdefizit ein höheres Einkommen der Ökonomie realisieren. Das ist genau die Erkenntnis von Keynes und bedeutet, dass der Staat mit seinem deficit spending auch jede Krise verhindern oder beenden kann. Denn die Krise gibt es nur, weil die Bürger ihre gewünschte Ersparnis nicht erzielen können und sich daher durch die Kürzung ihrer Ausgaben immer weiter arm sparen. Der Staat kann dies einfach verhindern, indem er sich im nötigen Umfang verschuldet, so dass die Bürger ihre gewünschte Ersparnis erhalten. Natürlich sollte die Zentralbank vorher noch die Zinsen senken, nicht nur nominal, sondern nach Möglichkeit real.
Weil der Staat mit seinem Defizit das Einkommen der Ökonomie steuert, kann von einem Gleichgewicht des Gütermarktes keine Rede sein. Denn der Zusammenhang zwischen der Ersparnis und den Staatsdefiziten zusammen mit der Nettoinvestition ist eine Identität, wie von Keynes bewiesen wurde. Das wird von Blanchard/Illing in dem oben zitierten Satz eingestanden, aber in der ganzen übrigen Darstellung dem Leser verschwiegen und wahrheitswidrig immer ein Gleichgewicht behauptet:
Zusammenfassend: Es gibt zwei äquivalente Methoden, um die Gleichgewichtsbedingung auf dem Gütermarkt zu formulieren:
Produktion = Nachfrage
Investition = Ersparnis
Makroökonomie, Blanchard/Illing, München 2009, S. 103.
Die beiden Methoden sind tatsächlich äquivalent, es handelt sich nämlich in beiden Fällen um eine Tautologie oder Identität, die den Studenten als Gleichgewichtsbedingung dargestellt wird. Tatsächlich gilt immer Investition = Ersparnis in einer Ökonomie und äquivalent gilt Produktion = Nachfrage; auch von 1929 bis 1933 war nach diesen beiden Kriterien der Gütermarkt immer im Gleichgewicht in allen Ländern. Die VWL diskutiert meines Wissens nie ein mögliches Ungleichgewicht des Gütermarktes. Sie behauptet dafür ständig, dass die Märkte von selber zu ihrem Gleichgewicht streben, wie etwa von 1929 bis 1933 oder gerade wieder in den Euro-Krisenstaaten.
Wenn Sie die völlig verwirrende und irreführende Darstellung bei Blanchard/Illing oder deren Wiedergabe bei Wikipedia lesen, sollten Sie mit meinen Hinweisen jetzt erkennen, wie Sie gezielt mit einer Identität oder Tautologie als Gleichgewichtsbedingung getäuscht werden. Für den VWL-Gütermarkt gibt es gar keine Gleichgewichtsbedingung, so dass er auch einmal im Ungleichgewicht sein könnte.
In allen Gleichgewichtsmodellen der VWL fehlt das Geldvermögen
Sie können das am Beispiel des Arrow-Debreu-Gleichgewichtsmodells schön sehen: Da wird die Nachfrage nach Gütern und deren Produktion diskutiert. Mit einem riesigen Aufwand an Mathematik betrachtet und berechnet man die möglichen Konsumbündel und die Präferenzen der Haushalte zusammen mit den Ressourcen der Ökonomie und den Plänen der Unternehmen zur Maximierung ihrer Gewinne. Ein Gleichgewicht nach Walras sei dann gegeben, wenn die aggregierte Überschussnachfrage Null ist, das bedeutet, dass es schon mal von einer Ware zu viel geben wird und von einer anderen Ware zu wenig - das gleicht sich dann aber über den Preis aus.
Nur das Geld wird nicht betrachtet: Die Haushalte wollen ja auch sparen, also einen Überschuss an Einnahmen erzielen, wofür andere Sektoren sich genau in der Höhe verschulden müssten. Sonst führt der Versuch der Haushalte, ihre Ausgaben zu reduzieren, zu einer Unterauslastung des Produktionspotenzials.
Das Thema ist im Modell von Arrow-Debreu nicht vorhanden. Ob die Haushalte, Unternehmen und der Staat ihre jeweiligen Sparziele erreichen, bleibt unerörtert. Damit kann es aber eben auch kein Gleichgewicht geben, weil das Modell für dessen Diskussion unzulänglich ist und die monetären Einflusse nicht behandelt.
Der wahre Hintergrund der Gleichgewichtslehre
Mit der Behauptung, die Märkte würden von selber ein optimale Gleichgewicht anstreben und finden, soll die Politik aus der Verteilung der Einkommen herausgehalten werden. Es handelt sich bei den
GE/DSGE-Modellen um Werkzeuge der Plutokratie gegen das Volk: DSGE is a plutocratic
tool
Die Geldpolitik muss die Märkte und damit die Konjunktur steuern
Die Geldpolitik muss bewusst eine optimale Auslastung der Ökonomie anstreben, indem sie gezielt gegen die das Ungleichgewicht verschärfenden Marktprozesse wirkt. Einen Boom sollte die Geldpolitik (wozu auch die Finanzpolitik zu zählen ist) also mit restriktiven Mitteln wie der Erhöhung der Leitzinsen und Steuern bei Einschränkung der Staatsausgaben dämpfen, umgekehrt eine Rezession durch expansive Kreditpolitik und kreditfinanzierte Staatsausgaben beenden. Oft genug werden aber Boom und Krise absichtlich verschärft oder man erzählt dem Publikum in Krisen, dass die Märkte sich selbst überlassen zum Gleichgewicht kämen, weil es Profiteure der Krisen gibt.
Wirtschaftskrisen werden absichtlich inszeniert und können jederzeit durch die richtige Geldpolitik beendet werden. Das sollen Studenten und Publikum nicht ahnen. Daher lehrt die VWL konstruierte Modelle mit neutralem Geld, in denen die Märkte von selber zum Gleichgewicht streben, statt von einer geeigneten Geldpolitik immer gegen die Marktkräfte an einen optimalen Auslastungsgrad hingeführt werden zu müssen. Die VWL stellt dazu sämtliche realen Zusammenhänge auf den Kopf. Während in Wahrheit die Arbeitslosenzahlen durch Krisen plötzlich hochschnellen, ist in der VWL die Arbeitslosigkeit immer freiwillig, eine Folge überhöhter Lohnforderungen. Warum in der Realität vor der Krise die Beschäftigung bei hohen Löhnen hoch war und nach der Krise bei niedrigeren Löhnen mehr Menschen erwerbslos sind, ignoriert die VWL einfach. Realität und Wirtschaftsgeschichte sind kein Thema, es zählen nur die Trugschlüsse aus den konstruierten Modellen.
Meine Warnung vor einem VWL-Studium
Das schockierende Erlebnis von Wirtschaftskrisen, bankrottierenden Unternehmen und der Verelendung von Abermillionen lohnabhängiger Arbeiter und ihrer Familien wurde meist der Anlass für die Beschäftigung mit makroökonomischen Zusammenhängen. Die Aufgabe der Ökonomen war es daher seit David Ricardo und Jean Baptiste Say, allein schon die Möglichkeit von Absatzkrisen generell zu leugnen und vor allem die gezielte Verursachung der Krisen durch die Geldpolitik zu verbergen.
Wer ein Studium der Theologie beginnt, weiß, was ihn da erwartet, ein Student der VWL ahnt es in der Regel nicht. Er hat sich vielleicht gerade deshalb für das Studium der VWL entschieden, weil er ökonomische Zusammenhänge verstehen möchte. Aber die Studenten werden wirksam mit irreführenden Modellen indoktriniert, bei denen nicht nur die Annahmen und Voraussetzungen jeder Realität widersprechen, sondern auch alle weiteren Schlussfolgerungen eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz sind. Nur wer das mitmachen will und vor sich vertreten kann, wird später ein für dieses System brauchbarer Ökonom und vielleicht sogar noch einmal auf einen Lehrstuhl berufen.
Machen Sie sich keine Hoffnung auf Ruhm und Karriere durch eine wissenschaftliche Widerlegung der herrschenden Lehre: Die sogenannte Wirtschaftswissenschaft ist längst in allen Punkten widerlegt, da braucht es keine weitere Forschung. Das stört die Professoren und ihre Auftraggeber aber nicht. Die belegen weiter ihre Thesen mit den Annahmen ihrer Modelle oder fabulieren von der “Neutralität des Geldes”, obwohl das wohl niemand ernsthaft glauben wird. Die “Neutralität des Geldes” oder andere Dogmen der VWL wissenschaftlich zu diskutieren, ist ungefähr so, als wollte man die Wundergeschichten der Bibel mit den Erkenntnissen der Physik widerlegen. Da macht man sich eigentlich nur lächerlich, weil jeder weiß, dass diese Dogmen halt den herrschenden Interessen dienen und von keinem intelligenten Menschen ernst genommen werden.
Am Ende dieses Überblicks über die Volkswirtschaftslehre sollen Sie kurz und knapp die ganzen Verwirrspiele und Trugschlüsse der VWL seit Ricardo und Say kennengelernt und durchschaut haben. Nehmen Sie sich die Zeit für die unterhaltsame Lektüre und ersparen Sie sich damit ein VWL-Studium.
Warum so komplizierte mathematische Formeln in der VWL?
Würden die Professoren ihre Lehren und deren Herleitung in klaren Worten vortragen, würden sie selbst von den dümmsten Studenten dafür auf der Stelle ausgelacht. Die Professoren umgehen dieses Problem, indem sie ihre Zirkelschlüsse in umständlichen Formeln verbergen, so dass die Studenten bis zur letzten Prüfung damit beschäftigt sind, die mathematische Darstellung überhaupt zu verstehen. Der Professor kann immer behaupten, die Annahmen des Modells und die zirkuläre Argumentation wären jetzt nicht das Thema, sondern die Berechnung der Kurve. Darum gibt es gegen die Modellbau-Dogmen der VWL keinen Aufstand der Studenten, solange die Professoren die Studenten mit unnötig komplizierten Formeln und der Diskussion von Kurven und Schnittpunkten von jedem grundsätzlichen makroökonomischen Gedanken abhalten können.
Die VWL-Professoren argumentieren mit einem Trick, vergleichbar dem Gaukler, der das Publikum ablenkt, während er das Kaninchen aus dem Zylinder zaubert wie der Professor den Beweis aus dem Modell. Die VWL-Modelle mit ihren versteckten Annahmen und Voraussetzungen sind das Kaninchen im Zylinder, von dem mit äußerst schwierigen Berechnungen von Kurven und Schnittpunkten aus kompliziertesten mathematischen Formeln abgelenkt wird, bis die feierliche Präsentation des Kaninchens aus dem Zylinder erfolgt, also der ökonomische Trugschluss aus den Annahmen und Voraussetzungen des Modells. Die Professoren verbergen hinter diesem ausgefeilten mathematischen Formelschleier ihre völlig lächerliche zirkuläre und tautologische Argumentation. Die makroökonomische These, die mit den Annahmen und Voraussetzungen des ökonomischen Modells schon vorgegeben war, soll den Studenten als Ergebnis hoch wissenschaftlicher Berechnungen erscheinen.
Mancher Student der VWL wird nach der Abschlussprüfung für den Rest seines Lebens das Gefühl nicht mehr los, dass er um alle wirklich wichtigen Fragen nach den Ursachen der Krisen und der Verteilung von Einkommen und Vermögen Semester für Semester nur herumgerechnet hat. Selten wird er zu dem für sich selbst vernichtenden Eingeständnis kommen wollen, dass mit der ausgefeilten Mathematik seiner Studienjahre nur alberne Zirkelschlüsse im VWL-Modellbau produziert wurden. Daher verbreitet sich die Erkenntnis des Schwindels nur schwer, denn wer sich erst einmal die ganze Mühe mit diesem Studium gemacht hat, will nicht auch noch dastehen wie der letzte Trottel.
Grundsätzlich gilt für die Diskussion der VWL-Modelle der bekannte Ausspruch von Robert Solow, der auch für das Solow-Wachstumsmodell zutrifft:
Suppose someone sits down where you are sitting right now and announces to me that he is Napoleon Bonaparte. The last thing I want to do with him is to get involved in a technical discussion of cavalry tactics at the Battle of Austerlitz. If I do that, I’m getting tacitly drawn into the game that he is Napoleon Bonaparte.
Sobald Sie sich darauf einlassen, die Details des Modells zu diskutieren, also zum Beispiel wie stark die Beschäftigung steigt, wenn man die Löhne senkt und die Profite erhöht, oder wie der Kapitalstock im Solow-Modell durch das Sparen am Konsum wächst, hat der Professor Sie hereingelegt und dazu gebracht, die unbelegten Grundannahmen seines Modells zu übernehmen. Die Profs kennen sich da aus, wie man an Solow sieht, in dessen Modell das Wachstum der Wirtschaft mal wieder durch Konsumverzicht erspart werden musste, als Argument für hohe Profite und niedrige Löhne wegen angeblichem Kapitalmangel als Wachstumshemmnis. Da dürfen Sie dann das Sparverhalten modellieren, also wie eine Erhöhung der Zinsen oder der Profite bei sinkenden Löhnen die Kurve des Wachstums der Ökonomie nach oben verschiebt.
Keynes über Ricardo
„Ricardo bietet uns die höchste geistige Leistung, unerreichbar für schwächere Geister, eine hypothetische Welt außerhalb der Wirklichkeit anzunehmen, als ob sie die Welt der Wirklichkeit wäre, und dann beständig in ihr zu leben. Die meisten seiner Nachfolger konnten dem gesunden Menschenverstand nicht den Einbruch verwehren – unter Verletzung ihrer logischen Folgerichtigkeit.“
(Keynes, Allgemeine Theorie, Berlin 1983, S. 161)
Tautologie und Zirkelschluss im VWL-Modellbau
Die VWL argumentiert nicht deshalb mit Modellen, weil ökonomische Zusammenhänge so kompliziert wären, sondern weil sich nur aus konstruierten Modellen die den herrschenden Interessen dienenden Behauptungen herleiten lassen. Tautologie und Zirkelschluss auf der Grundlage der Annahmen und Voraussetzungen dieser Modelle sind dabei die wesentlichen Argumentationsweisen der VWL-Professoren.
By the late 20th century the term “neoclassical” had come to connote a deductive body of free-trade theory using circular reasoning by tautology, excluding discussion of property, debt and the
financial sector’s role in general, taking the existing institutional environment for granted.
Der Vorwurf der Tautologisierung ihrer Modelle wurde bereits von Hans Albert im Jahr 1963 umfangreich an Beispielen erläutert:
HANS ALBERT
Modell-Platonismus
[Der neoklassische Stil des ökonomischen
Denkens in kritischer Beleuchtung]
Die Produktionsfunktion
Mit der in der VWL verwendeten Produktionsfunktion sind bereits alle später hergeleiteten Dogmen vorgegeben. Dabei wird genau diese Produktionsfunktion niemals wirklich diskutiert, sondern als völlige Selbstverständlichkeit ganz nebenbei vorgestellt: Alles Wirtschaften bestehe einfach darin, Kapital und Arbeit optimal zur Erzielung eines möglichst hohen realen Outputs zu verknüpfen; was optimal ist, regele der Markt und die Konkurrenz, indem die weniger optimalen Verknüpfungen nicht rentabel arbeiten und damit nicht genug Rendite für das Kapital und nicht genug Lohn zur Bezahlung der Arbeit einbringen und zu Gunsten effizienterer Verknüpfungen aufgegeben werden müssen.
Ihre allgemeine Funktion lautet:
Y = f ( K, N)
Alle weiteren Ableitungen der VWL sind eine Tautologie dieser Funktion. Denn mit dieser Funktion wird unterstellt, dass der Output einer Ökonomie allein eine Funktion der Inputmenge an Kapital und Arbeit wäre. Das heißt aber:
Eine Wirtschaftskrise kann nur die Folge von Kapitalmangel (unzureichende Profite, zu wenig Ersparnis) oder unzureichendem Arbeitseinsatz (Faulheit der Erwerbslosen, zu hohe Lohnforderungen) sein!
Was auch immer die Professoren später herumrechnen, kann immer nur auf diese Diagnose eines Mangels an Kapital oder Arbeitseinsatz hinauslaufen. Das ist mit dieser den Studenten ganz nebenbei vorgestellten Produktionsfunktion bereits alternativlos vorgegeben, weil vorsätzlich nur die eingesetzte Menge an Kapital und Arbeit zur Erklärung des Einkommens der Ökonomie betrachtet wird.
Nun fragen wir uns einmal: Können ein Konjunktureinbruch oder gar eine Wirtschaftskrise wirklich eine Folge von plötzlichem Kapitalmangel oder plötzlich unzureichendem Arbeitseinsatz sein? Kann ein Boom in einer Ökonomie umgekehrt mit plötzlich besonders hohem Einsatz von Kapital und Arbeit erklärt werden?
Selbstverständlich nicht! Die Produktionsfunktion der VWL ermöglicht aber in ihrer Form Y = f (K, N) gar keine andere Erklärung für einen Konjunkturverlauf. Um die Konjunktur anders zu erklären, etwa monetär, müsste zuallererst diese Produktionsfunktion aufgegeben werden.
Den Studenten ist in der Regel nicht klar, dass mit dieser Produktionsfunktion der Erklärungsrahmen der VWL gewaltig eingeschränkt wird. Der Rest ist Tautologie: Der Zins oder die Kapitalrendite als Grenzprodukt des Kapitals (bei konstanter Arbeitsmenge), der Lohn als Grenzleistungsfähigkeit der Arbeit (bei Konstanz des Kapitals). Die Erhöhung der Arbeitsnachfrage durch sinkende Löhne. Die Überwindung des Kapitalmangels durch Sparen. Selbst das Say´sche Theorem folgt notwendig aus dem angeblichen Kapitalmangel, denn wo Kapital dringend fehlt und gebraucht würde, dort kann es ja nie eine mangelnde Güternachfrage geben. Das alles sind nur Tautologien dieser Produktionsfunktion.
Die Produktionsfunktion mit technologischem Faktor
Einige Wachstumstheorien der VWL haben später noch einen Faktor A zur Erklärung des technischen Fortschritts und der steigenden Effizienz der Produktion eingeführt. Es war bei einer langfristigen Betrachtung der Ökonomie doch zu offensichtlich geworden, dass die Leistung einer Ökonomie nicht einfach durch das langfristige, harte Sparen von immer noch mehr Kapital steigt.
Damit lautet die Produktionsfunktion so:
Y = A * f ( K, N) oder Y = f(A, K, N) oder auch Y = f(K, AN)
Dieser Faktor A wird aber niemals monetär oder konjunkturpolitisch verstanden, sondern er soll einfach den technologischen Stand der Ökonomie beinhalten und wird wohl kurzfristig als konstant angenommen, so dass sich nichts daran ändert, dass Konjunkturschwankungen nur als Ergebnis der angeblich schwankenden Einsatzmengen der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit gedacht und analysiert werden können.
Damit kann die Lösung der VWL zur Überwindung von Krisen immer nur in der Erhöhung des Kapitaleinsatzes durch Konsumverzicht (höhere Profite für das Kapital) und in höherem Arbeitseinsatz durch Lohnverzicht (und Sozialabbau, um den Lohnverzicht durchzusetzen) bestehen.
Das könnte man ja diskutieren, wenn die Professoren dies den Studenten bei der Vorstellung ihrer Produktionsfunktion so erklären würden. Genau dies erklären die Professoren aber nicht und die Studenten dürfen für den Rest ihres Studiums staunen, wie die diversen, auf dieser Produktionsfunktion aufgebauten Modelle immer wieder beweisen, dass die Löhne sinken und die Profite steigen sollten.
Das angeblich neutrale Geld
Wenn die Produktionsfunktion Y = f ( K, N) dem Modell zugrunde liegt, kann selbstverständlich (sozusagen tautologisch) alles, was in der Produktionsfunktion als Faktor nicht auftaucht, auch gar keinen Einfluss auf den Output der Ökonomie haben. Vor allem das Geld kommt in dieser Produktionsfunktion nicht vor und ob die Zentralbank eine expansive oder restriktive Kreditpolitik des Bankensystems erzwingt, kann das Ergebnis der Produktionsfunktion nicht ändern. Damit haben die Professoren durch einen ganz einfachen Zirkelschluss schon alles bewiesen, was sie beweisen sollen und wollen:
Geld soll angeblich neutral sein und keine Auswirkungen auf die realen ökonomischen Zusammenhänge haben. Der Geldschleier, so die VWL-Professoren, verberge die realen Zusammenhänge der Ökonomie. Wer dem Geld eine reale Wirkung auf die Wirtschaft unterstelle, erliege einer Geldillusion, verwechsle womöglich nominale und reale Größen.
Weil Wirtschaftskrisen monetäre Ursachen haben und die Leugnung der Verursachung dieser Krisen durch die Geldpolitik die wichtigste Aufgabe der Volkswirtschaftslehre ist, kommt in den Modellen der Ökonomen nur ein neutrales Geld als Tauschmittel vor. An den Wirtschaftskrisen könnten nur die Arbeitslosen schuld sein, die freiwillig erwerbslos bleiben, weil sie halt zu den vom Markt bestimmten Löhnen und sonstigen Bedingungen nicht arbeiten möchten, beweisen die Professoren mit ihren Modellen. Niedrigere Löhne und Sozialleistungen für die Arbeiter, höhere Profite für das Kapital und stabiles Geld für die Rentiers müssten durch die Wirtschaftspolitik durchgesetzt werden, so die bekannten Mietmäuler und Soldfedern der Kapitalinteressen als Doktoren und Professoren und hochgeehrte Wirtschaftsweise jeden Tag in allen Massenmedien. Derartige wirtschaftspolitische Empfehlungen lassen sich mit Modellen ohne richtiges Geld ganz leicht und einwandfrei aus den Voraussetzungen und Annahmen dieser Modelle herleiten.
Ein Blick auf die Geschichte der Wirtschaft könnte die vielen von der Geldpolitik verursachten Krisen und deren Hintergründe aufdecken. Deshalb ist eine Untersuchung der ökonomischen Zusammenhänge am Beispiel der Wirtschaftsgeschichte in der VWL nicht erlaubt und einst bekannte historische Werke und Schulen werden totgeschwiegen. Statt um historische Erfahrungen geht es nur um Modelle, von denen die klassischen und neoklassischen Modelle die Absatzkrisen ganz grundsätzlich leugnen, während die angeblich keynesianischen Modelle in der VWL eine dreiste Verdrehung des wirklichen Keynesianismus und eine gezielte Täuschung der Studenten und des Publikums sind. Bis heute werden an den Universitäten die Fälschungen und Irreführungen der Gegner von John Maynard Keynes als keynesianische Modelle gelehrt, vor allem das IS-LM-Modell der sogenannten Neoklassischen Synthese von Hicks und Samuelson. Die meisten Studenten glauben wirklich, sie hätten mit dem völlig absurden IS-LM-Modell die Lehren von Keynes studiert, und wollen sich nie mehr näher mit dessen Theorien und originalen Schriften beschäftigen, was genau das Ziel der Professoren war.
Mit den bis hier angeführten Punkten wäre der VWL-Modellbau bereits als restlos widerlegt und erledigt zu betrachten, gäbe es im Kapitalismus so etwas wie eine ehrbare Wissenschaft. Es gibt diese aber nicht und Sie sollten sich noch etwas Zeit für einige Details des ganzen Schwindels der VWL-Professoren nehmen. Ich werde es möglichst kurz und knapp halten.
Indoktrination mit dem AS-AD Modell

Das pseudokeynesianische AS-AD-Modell ist eigentlich nur eine auf den Faktor Arbeit eingeschränkte Produktionsfunktion. Während der ganze mathematische Krimskrams, mit dem die Professoren das Modell aufbauen, nur der Verwirrung der Studenten dient, wollen wir hier den Kern des AS-AD-Schwindels kurz diskutieren:
AS-AD-Modell:
Y = f(Arbeit), Kapital wird als konstant behandelt
Pe: erwartetes Preisniveau, Yn: natürliche Produktion bei natürlicher Arbeitslosigkeit
Der Verlauf der AS-Kurve ergibt sich aus der durchaus plausiblen Annahme, dass eine steigende Produktion mit einer steigenden Auslastung des Potenzials verbunden zu steigenden Preisen führe und umgekehrt. Wir sehen also eine von links unten nach rechts oben steigende Kurve, die allerdings als Gleichgewichtskurve behandelt wird, was unbegründet bleibt. Denn weit links und weit rechts von der optimalen Auslastung Yn käme es eben nicht zu einem Gleichgewicht, sondern zu entweder immer mehr steigenden oder fallenden Preisen.
Die AD-Kurve wird aus dem bastardkeynesianischen IS-LM-Modell abgeleitet. Das dient einmal der unwahren Behauptung, dass das AS-AD-Modell auf Erkenntnissen von Keynes beruhe. Zweitens wird bei der Ableitung aus der LM-Kurve die fixe Geldbasis aus dem IS-LM-Schwindel als zentrale Grundlage für die von links oben nach rechts unten fallende AD-Kurve übernommen, ohne diesen Punkt wirklich zu diskutieren. Bei einer fixen Geldmenge würden natürlich hohe Preise mit einem niedrigen Y und niedrige Preise mit einem hohen Y verbunden sein. Aber bei Fiat Money gibt es keinen Grund für eine beschränkte Geldmenge, außer der bösen Absicht der Zentralbank, einen Anstieg von Y durch Hochzinspolitik zu unterbinden. Die Zentralbank ist der einzige Anbieter der sogenannten Geldmenge und sie macht damit die Zinsen und nicht der Markt. Das zu verschleiern war ja bereits die Grundlage des IS-LM-Modells.
Das Modell geht von einer natürlichen Arbeitslosenrate und einem natürlichen Produktionsniveau Yn aus. Wenn wir es ganz kurz erledigen wollen: Ausgehend von diesem natürlichen Produktionsniveau wird eine expansive Geldpolitik diskutiert, die dann nur zu einem "übernatürlichen" Produktionsniveau führen kann. Denn die Ökonomie war ja schon vor der expansiven Geldpolitik voll ausgelastet. Diese expansive Geldpolitik führt jetzt zu stark steigenden Preisen, so dass mittelfristig die Geldpolitik entweder noch viel expansiver werden müsste, oder aber die Beschäftigung wieder auf das natürliche Niveau sinkt, sobald die Arbeiter merken, dass ihr Lohn wegen der Inflation real nicht steigt.
Selbstverständlich ist dies kein Beweis für die Nutzlosigkeit expansiver Geldpolitik in einer Krise, wird aber von den Professoren genau so verwendet. Der angebliche "Beweis für die mittelfristige Neutralität des Geldes" beruht allein darauf, dass die Ökonomie schon ohne die expansive Geldpolitik mit einem Einkommen von Yn optimal ausgelastet war. Dümmer geht es nimmer, oder doch?
Ein negativer Nachfrageschock soll das Einkommen nach links fallen lassen. Das kann zum Beispiel durch eine Senkung des Haushaltsdefizits des Staates erfolgen. Jetzt wäre nach Keynes zu diskutieren, dass ein geringeres Haushaltsdefizit ja die mögliche Ersparnis der privaten Haushalte senkt, die sich dann nach dem Sparparadoxon weiter in die Krise sparen. Nicht so im AS-AD-Modell: Hier ist das einfach kein Thema!
Im AS-AD-Modell hat die Ökonomie nämlich keine Probleme, wieder zu einem Einkommen von Yn zurück zu kommen. Es wird letztlich unterstellt, dass die Unternehmen mit zusätzlichen Investitionen trotz sinkender Preise, also Deflation, für die gewünschte Ersparnis der Haushalte sorgen. Das wird so aber nicht diskutiert, sondern nur ohne weitere Begründung unterstellt, denn anders könnte es nach dem Haushaltsausgleich gar nicht zu wachsenden Einkommen kommen. Das Problem existiert also nur deshalb nicht, weil es im AS-AD-Modell nicht vorgesehen ist! Aber es geht so noch weiter.
Der angebliche Beweis der mittelfristigen Neutralität des Geldes:
Das Modell soll beweisen, dass Geld mittelfristig neutral sei und dass auch die Produktion nur kurzfristig von ihrem natürlichen Niveau abweiche. Dazu werden kurzfristige monetäre Impulse diskutiert, die dann mittelfristig korrigiert werden. Zum Beispiel führt eine kurzfristig restriktive Geld- oder Finanzpolitik zu einem kurzfristigen Sinken des Einkommens der Ökonomie, danach wird diese restriktive Geld- und Finanzpolitik nicht fortgesetzt, sondern korrigiert, und, oh Wunder, damit steigt auch das Einkommen wieder auf das Niveau vor dem kurzfristig negativen Impuls.
Selbstverständlich hat eine kurzfristig restriktive Politik nur einen kurzfristig restriktiven Einfluss auf das Einkommen der Ökonomie, der mittelfristig wieder zu korrigieren ist. Damit ist nicht bewiesen, dass das Geld mittelfristig neutral wäre. Um das zu beweisen, müsste eine nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig restriktive Geld- und Finanzpolitik ohne negative Auswirkungen auf das Einkommen der Ökonomie bleiben. Genau das haben die Ökonomen aber gar nicht zu beweisen versucht, sondern betreiben nur den lächerlichsten Dummenfang mit einem kurzfristig negativen und mittelfristig wieder korrigierten monetären Impuls. Die AD-Kurve wurde nämlich aus dem IS-LM-Modell abgeleitet und unterstellt, dass die Geldpolitik bei sinkender Preisentwicklung in Relation zum zuvor erwarteten Preisniveau expansiv wird. Darum verläuft die Anpassung nach einem negativen Schock entlang der AD-Kurve wieder zum ursprünglichen Einkommen. Das ist nicht der Beweis für die mittelfristige Neutralität des Geldes, sondern es ist vielmehr eine mittels der AD-Kurve unterstellte und so vor dem Publikum versteckte expansive Geldpolitik, die den negativen Schock auf mittlere Frist korrigiert.
Es werden nur Schwankungen des Arbeitseinsatzes diskutiert! Für diese Schwankungen des Arbeitseinsatzes sind allein die Arbeiter und freiwillig Arbeitslosen verantwortlich. Diese können sich nämlich in Bezug auf die Entwicklung des Preisniveaus täuschen und entweder bei einem vermeintlich gestiegenen Reallohn mehr als den üblichen Arbeitseinsatz anbieten oder auch bei einem vermeintlich gesunkenen Reallohn die Arbeit verweigern.
Das AS-AD-Modell erfreut sich höchster Beliebtheit bei den VWL-Professoren und in allen VWL-Lehrbüchern. Erstens können die Professoren ihre Studenten mit ganz komplizierten Formeln und Berechnungen verwirren und zweitens lassen sich die Dogmen der VWL im Verlauf der Kurvenberechnungen in die Köpfe der Studenten einpflanzen.
Eine kurzfristig expansive Geld- und Fiskalpolitik zum Beispiel erhöhe die Produktion nur dadurch, dass die Arbeiter ihren Reallohn überschätzen und sich darum auf mehr Arbeit einlassen. Die Arbeiter würden den durch die expansive Geld- und Fiskalpolitik verursachten Preisanstieg nicht berücksichtigen, aber sobald sie ihren Irrtum erkannt haben, stellen sie ihre Mehrarbeit wieder ein. "Q.E.D. - expansive Geld- und Finanzpolitik bewirken nur ein Strohfeuer mit erhöhter Inflation", beweist der Professor grinsend an der Tafel mit seinem Modell, das zur Belebung der Konjunktur gar kein anderes Mittel enthält als die Täuschung der Arbeiter über ihren Reallohn durch Inflation.
Man könnte sich ebenso ein Modell ausdenken, in dem nur die Bundesligatabelle über den Arbeitseinsatz entscheidet, um damit die keynesianische Geld- und Finanzpolitik für wirkungslos und widerlegt zu erklären, weil die ja keinen Einfluss auf die Tore hat.
Eine Wirtschaftskrise funktioniert im AS-AD-Modell ganz ähnlich, nur umgekehrt: Kurzfristig restriktive Geldpolitik oder ein negativer Nachfrageschock haben sinkende Nominallöhne bewirkt, die aber wegen der ebenfalls sinkenden Preise nichts am Reallohn ändern würden, so das Modell in seinen Annahmen und Voraussetzungen. Die Arbeiter sind jedoch wegen ihrer falschen Preiserwartung von sinkenden Reallöhnen ausgegangen und haben deshalb ihre Arbeit verweigert und wurden freiwillig arbeitslos. Je nach Modellvariante und Professor lassen sich noch pseudokeynesianische Rigiditäten bei der Anpassung der Löhne und Preise umständlich diskutieren, die sogar das Zugeständnis einer wegen der Rigiditäten kurzfristig unfreiwilligen Arbeitslosigkeit im Modell erlauben.
Ohne rigide Löhne und Preise und uneinsichtige Arbeiter würde es zu gar keinem Einbruch der Produktion kommen, aber nach einiger Zeit erkennen die Arbeiter endlich ihren Irrtum und sehen, dass der Reallohn gar nicht gefallen ist. Jetzt arbeiten sie (im Modell) wieder so viel wie früher, womit er bewiesen habe, erklärt der Professor stolz den Studenten, dass restriktive Geldpolitik wie andere negative Schocks mittelfristig keinen Schaden anrichten und kurzfristige Abweichungen nach unten vom Markt selbst behoben werden. Um den Lernprozess der Arbeiter zu fördern und ihre Uneinsichtigkeit auszutreiben, sollte die Unterstützung für Arbeitslose möglichst eingeschränkt werden.
Das wird den Studenten selbstverständlich nicht so wie hier erklärt, sondern sie müssen für diesen Zirkelschluss ganz viele komplizierte Kurven zeichnen und Formeln berechnen, bis sich die gewünschte Schlussfolgerung ergibt. Dieser Betrug wird im Internet auch schon mal als schmutzige Pädagogik diskutiert:
David Colander and Peter Sephton: Acceptable and Unacceptable Dirty Pedagogy - The Case of AS/AD
Die AD-Kurve ist eigentlich ein Fremdkörper im AS-AD-Modell, weil ja überhaupt nur der Arbeitseinsatz diskutiert wird und nirgendwo in diesem Modell Investitionen und das Sparen einen Einfluss auf die Produktion haben. Beim Modellbau hätten die Professoren auch jede andere von oben links nach unten rechts fallende Kurve für denselben Zweck missbrauchen können. Die AD-Kurve wurde jedoch ganz gezielt aus dem bastardkeynesianischen IS-LM-Modell hergeleitet und soll das AS-AD-Modell den Studenten als eine auf den Erkenntnissen von Keynes beruhende moderne Weiterentwicklung des Keynesianismus erscheinen lassen. Keynes mit Keynes widerlegt, da freuen sich die Professoren ganz besonders über ihre schmutzigen Tricks.

Lügen mit Statistik in der VWL
Lässt sich eine angebliche Neutralität des Geldes empirisch belegen? Nichts einfacher als das: Wir wissen, dass Wirtschaftskrisen durch Hochzinspolitik verursacht werden. Dabei löst die Hochzinspolitik den Einbruch der Konjunktur aus und sobald dieser erfolgt ist, werden die Zinsen gesenkt. Wir müssten uns also für den Beweis durch Statistik, dass hohe Zinsen gut für die Konjunktur seien und niedrige Zinsen Arbeitslosigkeit verursachen würden, nur ganz dumm stellen und einfach Wachstum und Arbeitslosigkeit zeitgleich mit der Höhe der Zinsen vergleichen. Und schon ist der Beweis erbracht, dass bei hohen Zinsen die Konjunktur gut läuft und bei sehr niedrigen Zinsen immer Massenarbeitslosigkeit herrscht. Dass die Hochzinspolitik zuerst die gut laufende Konjunktur abgewürgt hat und niedrige Nominalzinsen dann bei fallenden Löhnen und Preisen einen immer noch zu hohen Realzins bewirkt haben, ist in dieser Statistik nicht erkennbar, sondern sie zeigt einfach eine gute Konjunktur bei hohen nominalen Zinsen und eine Krise bei niedrigen nominalen Zinsen.
Reale ökonomische Auswirkungen der Geldpolitik auf die Löhne werden in der Regel von den Vertretern einer Neutralität des Geldes gar nicht angesprochen. Die mit Hochzinspolitik verursachte Massenarbeitslosigkeit hat seit Mitte der 1970er Jahre die Löhne vor allem im unteren Sektor nicht mehr steigen lassen, wie die Grafik rechts sehr eindrücklich zeigt. Das ist einer der wichtigsten Gründe für die Verursachung von Massenarbeitslosigkeit durch Hochzinspolitik neben der Spekulation.
Man kann statistische Lügen auch übertreiben, wie der VWL-Professor Adam in Mannheim, bei dem ist gar keine Rede von Zinsen, sondern nur von Geldmengen:
Neutralität des Geldes: Empirische Evidenz zur langen & kurzen Frist (PPT von Prof. Adam, Mannheim)
Der übliche Unsinn, wonach das "Wachstum der Geldmenge" nur die Preise steigen lassen würde. Weil von den Zinsen gar keine Rede ist, fragen wir uns vergeblich, ob denn der Anstieg der Preise nicht den Realzins senke und damit Konsum und Investitionen beflügle. Das ist bei Prof. Adam einfach kein Thema.
Mit Statistiken zu lügen, ist immer die beste Methode. Denn der Laie glaubt dem angeblichen Beweis durch Fakten lieber als jedem logischen Argument. Jetzt gilt es nur noch, die Fakten passend zu verdrehen, dann kann Prof Adam begeistert melden:
Langfristige Neutralität konsistent mit den Daten! (PPT S. 8)
Dass die restriktive Geldpolitik 1929-33 zu einer Weltwirtschaftskrise geführt hat und bis zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg die Massenarbeitslosigkeit dort nicht überwunden wurde, bedeutet nur, dass wir die Statistik so wählen müssen, dass dieser Zeitraum entweder ganz außerhalb oder am Rande liegt. Den seit über dreißig Jahren verursachten und längst unübersehbaren Wachstumseinbruch durch die monetaristische Geldpolitik ab dem Beginn der 80er Jahre im Vergleich zu den über dreißg Jahren vorher hat der Prof. Adam in keiner Statistik erkennen können: Seine Statistik reicht von 1960 bis 1990 und verwendet nach seinen Angaben "Für jedes Land Mittelwert über 30 Jahre: kurzfr. Effekte ausgefiltert". Dann war die von Paul Volcker mit FED-Zinsen von 20% im Jahr 1982 ausgelöste Weltrezession wohl ein ausgefilterter kurzfristiger Effekt. Näher will ich den Unsinn gar nicht mehr untersuchen. Mit Statistik könnte man sogar beweisen, dass Massenarbeitslosigkeit und wachsende Geldmengen korrelieren, wie Keynes mit der bekannten Liquiditätsfalle selbst erkannt hat - und seine anderen Erkenntnisse werden durch die VWL auch ständig übelst verdreht.
Es gibt makroökonomisch keinen Kapitalmangel

Wie die Abbildung zeigt, ist die Kapitalausstattung einer Volkswirtschaft im Verhältnis zum BIP gar nicht so sehr groß. Abhängig von der Methode der Berechnung kommen wir für 2012 auf ein gesamtes Sachvermögen in Deutschland von etwas über 12.500 Milliarden Euro bei einem BIP von mehr als 2.500 Mrd. Euro. Das ergibt eine Kapitalproduktivität von 0,2 oder verglichen mit dem Bruttosozialprodukt fünffach höhere Sachanlagen. Mehr als die Hälfte des Sachvermögens gehört privaten Haushalten und Organisationen ohne Erwerbszweck. Würde man nur ganz eng die zur Produktion nötigen Sachanlagen summieren, erhielten wir vielleicht das Doppelte des BIP. Es gibt unterschiedliche Ansätze der Berechnung, aber keinen wirklich erheblichen Kapitalbedarf:
Der Kapitalkoeffizient, das ist das Verhältnis von Realkapital zu jährlichem Konsum, ist in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr gewachsen und hat eine Größenordnung von etwa 5 Jahren. [gemeint ist hier, dass das Realkapital dem Konsum von 5 Jahren entspricht]
Carl Christian von Weizsäcker: Fazit vom 27.04.2012
Das zeigt schon, dass es keinen wirklichen Kapitalmangel in einer Ökonomie geben kann, auch wenn jeder einzelne Mensch natürlich dringend mehr Kapital für sich bräuchte, was die Argumentation der VWL in weiten Kreisen so einleuchtend erscheinen lässt.
Der angebliche Kapitalmangel ist ein zentrales Postulat für die krisenverschärfenden Lehren der VWL-Professoren. Der postulierte Kapitalmangel ist auch die Grundlage von Produktionsfunktionen der Sorte f(Kapital, Arbeit) wie die Cobb-Douglas-Funktion. Mit derartigen Funktionen lässt sich dann eine Grenzproduktivität der Arbeit als Erklärung der Lohnhöhe und eine Grenzproduktivität des Kapitals als Rechtfertigung für Zins und Profit erfinden. Mit anderen Worten: Hungerlöhne werden damit zu einem von den Gesetzen des Marktes gerechtfertigten Ergebnis der niedrigen Grenzproduktivität der Arbeit dieser Menschen ("also selber schuld"), hohe Profite und Zinsen dürfen den herrschenden Verhältnissen nicht zum Vorwurf gemacht werden, sondern wären halt die Folge des Kapitalmangels und ebenfalls durch die Gesetze des Marktes gerechtfertigt und sinnvoll. Jede Verletzung der Marktgesetze würde der Ökonomie schaden, vor allem die Erhöhung der Löhne in Tarifverträgen mit Gewerkschaften oder eine Senkung der Profite und Zinsen durch Steuern und die Geldpolitik oder gar Maßnahmen der Regierung wie gesetzliche Regulierungen gegen das Finanzkapital.
Die Geschichte von dem durch eine Grenzproduktivität der Arbeit bestimmten Marktlohn dient während jeder durch restriktive Geldpolitik verursachten Massenarbeitslosigkeit vor allem der Hetze gegen die Opfer der Krise, deren Arbeit eben am Markt den geforderten Lohn nicht wert sei. Die Rückkehr zur Vollbeschäftigung (oder einer höheren Beschäftigungsrate wie vor der Krise, als die Löhne allerdings noch viel höher waren) erfordere noch niedrigere Hungerlöhne, erklären die Professoren täglich in allen Massenmedien als Erkenntnis ihrer sogenannten Wissenschaft gegen jede Vernunft und jeden Anstand.
Dabei beruht das Argument einer sinkenden Grenzproduktivität der Arbeit allein auf der Annahme des Kapitalmangels: Nur wenn immer mehr Arbeiter mit zu wenig Kapital produzieren müssten, würde dies eine sinkende Produktivität der Arbeit durch eine steigende Menge der Arbeiter bewirken und sinkende Löhne zur Erhöhung der Beschäftigung erfordern. Der angebliche Kapitalmangel ist die ganze Begründung des Arbeitsmarktmodells der Neoklassik mit einer steigenden Arbeitsnachfrage bei sinkendem Marktlohn. Damit liefern die Professoren das Argument, die inszenierten Krisen zum Lohnabbau und zur Verschärfung der Ausbeutung der Arbeiter zu benutzen.
Wie sind diese angeblichen Wissenschaftler auf einen Kapitalmangel in der Ökonomie gekommen? Zunächst einmal werden die VWL-Professoren sich gedacht haben, weil jedem von ihnen ganz persönlich jede Menge Kapital fehlt, dann müsste dies doch auch für die ganze Wirtschaft gelten. So werden Aussagen über makroökonomische Zusammenhänge mikroökonomisch fundiert. Auch die Studenten und das Publikum kennen den Kapitalmangel ganz persönlich und schmerzlich aus eigener Erfahrung und zweifeln gar nicht erst an dieser Grundannahme der VWL.
Das ausschlaggebende Motiv der Professoren für die Theorie vom Kapitalmangel in der Ökonomie dürfte aber der Blick auf den eigenen Kontostand in einem tieferen Sinne gewesen sein, nämlich das Anliegen der Professoren, sich mit ihren Lehren den Kapitalisten anzudienen und ihren Kontostand dadurch zu verbessern. Denn der angebliche Kapitalmangel liefert die schönste Begründung für die immerwährende Forderung von VWL-Professoren nach Lohnsenkung und Sozialabbau sowie höheren Profiten, Subventionen und Steuergeschenken für das Kapital. Auf einem freien Markt sind halt auch die Lehren der VWL-Professoren käuflich, vor allem die Lehren der Professoren, die dem Markt in jeder Beziehung den Vorzug geben vor jeder “Anmaßung von Wissen” (Hayek).
Der wichtigste Grund für die These vom Kapitalmangel in Ökonomien ist aber die krisenverschärfende Wirkung der daraus abgeleiteten Forderungen nach Konsumverzicht. Angeblich würde jeder Konsumverzicht zu höheren Investitionen und mehr Arbeitsplätzen führen, was die Professoren mit ihrer gewohnten Zirkelschlussmethode zu belegen versuchen. Diese Zirkelschlüsse erfolgen etwa so:
Jedes Volkseinkommen, das nicht konsumiert, sondern gespart wird, erhöhe den Kapitalstock und damit die Grenzproduktivität der Arbeit. Nun könnten die Unternehmer bessere Löhne zahlen oder mehr Arbeiter einstellen. Konsumverzicht und verstärktes Sparen wären daher im eigenen Interesse der Arbeiter und der notwendige Konsumverzicht werde am wirksamsten durch die Erhöhung der Profite erreicht, mit denen die Unternehmer dann investieren und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.
So etwa lautet in Kurzfassung der ganze korrupte Unsinn der VWL speziell in den Zeiten der Wirtschaftskrise. Statt eine höhere Auslastung durch mehr Konsumnachfrage und damit die Erhaltung der Arbeitsplätze zu unterstützen, fordert die VWL Konsumverzicht und damit eine krisenverschärfende Politik der fortgesetzten Kapitalvernichtung durch Unterauslastung, also das ebenso beliebte wie berüchtigte Kaputtsparen der Ökonomie.
Haben Sie die zirkuläre Argumentation bemerkt? Meist sind diese Argumente dem Publikum schon so geläufig, dass sie gar nicht mehr hinterfragt werden.
Weil das Volkseinkommen aus Konsum und Investition besteht, ist selbstverständlich per Definition der Teil des Volkseinkommens, der nicht konsumiert wird, eine Investition; und zwar sogar eine Nettoinvestition, die das gesamte Produktionspotential gesteigert hat. Andernfalls, wenn es keine Nettoinvestition gewesen wäre, hätte die Investition nicht zum Volkseinkommen gezählt.
Was nicht Konsum ist, kann definitionsgemäß nur eine Investition sein, so wie alle Menschen, die nicht Männer sind, Frauen sein müssen; woraus VWL-Professoren vermutlich die Lehre ziehen würden, dass weniger Männer zu mehr Frauen führen, genau wie der Konsumverzicht zu mehr Investitionen. Hier wird einfach mit einem Trick bei den Studenten der VWL oder dem Publikum der Trugschluss erzeugt, dass jeder Konsumverzicht tatsächlich steigende Nettoinvestitionen bewirke und damit ein Kapitalmangel behoben würde, was sodann über eine steigende Grenzproduktivität der Arbeit höhere Löhne oder mehr Arbeitsplätze erlaube.
Bestärkt wird der Irrtum hier wieder durch die mikroökonomischen Vorstellungen:
Für jeden Einzelnen gilt, dass der Teil seines Einkommens, der nicht für Konsum verwendet wird, seine Ersparnisse erhöht. Nun übertragen die Leute diese Vorstellung auf die Makroökonomie und meinen, dass auch hier jeder Konsumverzicht zu steigenden Ersparnissen und diese zu wachsenden Investitionen führen müssten.
Diese Übertragung der mikroökonomischen Realität auf die Makroökonomie ist aber wieder völlig falsch, weil makroökonomisch jeder Verzicht auf Ausgaben einfach zu sinkenden Einnahmen führt (Ausgaben = Einnahmen!). Durch das Sparen am Konsum werden also in einer Makroökonomie alle ärmer, ihre Einkommen sinken mit dem Sparen. Zuletzt wird durch die gesunkene Güternachfrage sogar noch Kapital vernichtet. Das aber ahnen die in aller Regel nur mikroökonomisch denkenden Leute nicht, also die gewöhnlichen VWL-Studenten und die einfachen Bürger, während die Professoren ihren Schwindel selbstverständlich durchschaut haben und ganz gezielt verbreiten.
Der Trugschluss der VWL gipfelt in der Formel I = S. Mit dieser Formel im Kopf meinen die Studenten und glaubt das Publikum, dass Investitionen durch höhere Ersparnisse aus dem Konsumverzicht entstünden. In Wahrheit handelt es sich bei der Gleichung I = S um eine Identität, also um eine Tautologie und keinen kausalen Zusammenhang im Sinne von S => I (Sparen bewirkt Investition), wie es die Gleichungen Y = C + S mit S = Y - C und S = I suggerieren.
Die Investitionen können also nicht durch verstärktes Sparen und vor allem nicht durch ein verstärktes Sparen von Geld gesteigert werden. Wenn durch eine Investition der Kapitalstock tatsächlich wächst, was auch die entsprechende Auslastung des Kapitalstocks durch eine gestiegende Güternachfrage voraussetzt, dann haben wir durch diese Nettoinvestition auch definitionsgemäß eine reale Ersparnis in Gestalt eines höheren Kapitalstocks. Es gilt also I => S (Nettoinvestitionen bewirken eine Ersparnis; oder besser noch: Nettoinvestition ist eine Ersparnis; aber nicht umgekehrt).
Die VWL-Professoren versuchen stets, einen umgekehrten Zusammenhang zu suggerieren, als würde das Sparen durch Konsumverzicht zu einem höheren Kapitalstock führen. Damit dienen die Lehren der VWL in jeder Wirtschaftskrise zu einer Verschärfung dieser Krise durch weiter sinkende Güternachfrage.
Mit diesen Lehren wird stets eine Politik der hohen Zinsen (Belohnung für verstärkten Konsumverzicht zum Zweck des Sparens), der Senkung von Löhnen und Sozialleistungen (Senkung des angeblich zu hohen Konsums zum Zweck der besseren Kapitalbildung) und der restriktiven Finanzpolitik der öffentlichen Haushalte verbunden mit Subventionen und Steuergeschenken für das Kapital von den dafür vom Großkapital mit Forschungsaufträgen, Drittmitteln und Beraterkarrieren belohnten VWL-Professoren gefordert.
Ist Kapitalmangel überhaupt möglich?
Wenn Kapital knapp wäre und deshalb hohe Renditen einbringen würde, dann könnte der Kapitalstock mindestens in der Höhe dieser hohen Renditen jedes Jahr steigen. Der Kapitalstock müsste sich also bei einer Knappheitsrendite von 7% p.a. alle zehn Jahre verdoppelt haben, in dreißig Jahren verachtfacht – in 100 Jahren hätte der Kapitalstock sich schon um den Faktor 1024 gesteigert. Kapital kann also nicht fehlen.
Kapital kann vor allem auch deshalb nicht fehlen, weil seit vielen Jahrzehnten das Verhältnis von Kapitalstock zur Produktion nicht mehr steigt. Technischer Fortschritt steigert nicht nur die Arbeitsproduktivität, sondern auch die Produktivität des Kapitals. Für einen verdoppelten Kapitalstock müsste sich auch das BIP verdoppeln, selbst bei einer Akkumulation von nur 3,5% jährlich würden sich der Kapitalstock und die Produktion und damit die Einkommen alle 20 Jahre verdoppeln. Der Kapitalstock liegt seit Jahrzehnten etwa beim Fünffachen des BIP. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass mit steigendem BIP ein erheblicher Teil des Kapitalstocks im Wert ganz von selber wächst (Grundstücke, Gebäude, Patente und Lizensen), also von niemandem angespart werden muss. Ebenfalls seit Jahrzehnten ist der Kapitalstock bzw. das Produktionspotential nicht annähernd ausgelastet. Trotzdem fabuliert die VWL bei Kapitalüberschuss und Massenarbeitslosigkeit immer noch von der Grenzproduktivität von Arbeit und Kapital.
Wenn es nicht der Kapitalmangel ist, was beschränkt dann die Leistungsfähigkeit einer Ökonomie?
Die VWL weiß selbstverständlich schon längst, dass die Produktion nicht durch einen Mangel an Kapital limitiert wird. Die Produktionsfunktion f(Arbeit, Kapital) wurde deshalb um einen nicht näher bestimmbaren Faktor ergänzt, der einen von den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital unabhängigen Produktivitätsanstieg durch technischen Fortschritt darstellt. Dieser Faktor lässt sich nicht durch das Sparen von Kapital verbessern, wohl aber über den technischen Fortschritt hinaus noch ergänzen und verstärken durch bessere gesellschaftliche Verhältnisse, also weniger Korruption, Betrug, Unterdrückung und Ausbeutung und einen damit reibungsloseren Ablauf der ganzen Ökonomie.
Bis zur vollen Auslastung des Produktionspotentials ist es einfach die fehlende Güternachfrage, die das Wachstum des Outputs und des dafür nötigen Kapitalstocks beschränkt. Mehr Nachfrage führt zu mehr Produktion und zu erfolgreichen Nettoinvestitionen für dieses Wirtschaftswachstum. Weil die Politik jedoch von den Ausbeutern beherrscht wird, steigen die Masseneinkommen nur unzureichend mit dem Produktionspotential, was dann den ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt behindert. Verbreitete Armut unter den Lohnabhängigen schädigt sogar deren Leistungsfähigkeit: Die Opfer dieser neoliberalen Politik versuchen, so schlecht zu arbeiten wie sie bezahlt werden, und nicht die Dummen zu sein, die sich ehrlich abschinden, während die Ausbeuter sich ein schönes Leben auf Kosten der Fleißigen machen.
An der Auslastungsgrenze wird die Leistung einer Ökonomie durch gesellschaftliche Faktoren beschränkt. Der effiziente Einsatz von Kapital und die effiziente Produktion erfordern möglichst geringe Schäden durch Korruption und Kriminalität. Es sind einfach die herrschenden gesellschaftlichen Zustände, wie etwa korrupte Politiker oder VWL-Professoren mit ihren krisenverschärfenden Theorien, die das sonst mögliche Wachstum des allgemeinen Wohlstands in einer Ökonomie limitieren.
Unter korrupten Verhältnissen haben wir dann statt wachsendem Massenwohlstand und einem mit dem Wachstum einer effizienten Ökonomie automatisch steigenden Kapitalstock eine Wirtschaftskrise mit Kapitalvernichtung und Verelendung der arbeitenden Bevölkerung zu Gunsten der Bereicherung einer herrschenden, kriminellen Elite, vor allem skrupelloser Finanzspekulanten, die von inszenierten Krisen profitieren, und der Bereicherung ihrer Mietmäuler und Soldfedern auf den VWL-Lehrstühlen und in den angeblichen Wirtschaftsforschungsinstituten.
Die Cambridge-Cambridge-Kontroverse
Die auch als Kapitalkontroverse bekannte Debatte um die Grenzproduktivitätstheorie ist wieder ein typischer Dummenfang. Es geht dabei darum, einen völlig abwegigen Einwand gegen die Grenzproduktivität zum wichtigsten Kritikpunkt zu erklären, mit der verborgenen Absicht, viel überzeugendere Einwände zu unterdrücken. Das Publikum studiert dann diese Cambridge-Cambridge-Kontroverse und findet deren Argumente so nebensächlich, wie sie ja auch wirklich sind, so dass die Theorie der Grenzproduktivität des Kapitals mit derart Kritik eher bestärkt wird. Das ist selbstredend die Absicht solcher Kritiker, lassen Sie sich dabei nicht täuschen, denn der entscheidende Einwand gegen eine Grenzproduktivität des Kapitals ist eben, dass Kapital überhaupt nicht knapp ist, was seinerzeit gerade die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren mit stillstehenden Maschinen und leerstehenden Fabriken deutlich erwiesen hatte, was aber von diesen Kritikern der Neoklassik bis in die 1960er Jahren niemand erkannt haben wollte.
Die Kapitalkontroverse begann mit dem Einwand, dass die heterogenen Kapitalgüter wie Land, Gebäude, Maschinen, Patente nicht eindeutig bewertet und zu einem Kapitalstock addiert werden könnten. Das ist alles sicher richtig, aber völlig nebensächlich. Bei solcher intellektueller Korinthenkackerei als Kritik verweist die Neoklassik lachend auf die Märkte, die jedem Kapitalgut zu jeder Zeit irgendeinen Geldpreis zumessen. Und wer wollte dem Argument jetzt überzeugend widersprechen, ohne sich der ökonomischen Haarspalterei verdächtig zu machen?
Noch schlimmer kommt es dann mit dem Einwand von Piero Sraffa aus seiner Theorie der Warenproduktion mittels Waren (Reswitching). Da könne also plötzlich die Produktionsthechnik gewechselt werden, so dass ein ganz anderes Verhältnis an eingesetzen Mengen von Kapital und Arbeit resultiert, womit die Grenzproduktivität wegen der Unstetigkeit der Produktionsfunktion unstetig und damit unberechenbar wird. Mit solcher Kritik an der Neoklassik konnte nun wirklich seit den 1960er Jahren kein Hund hinter dem Ofen vorgelockt werden und das wird sich auch nicht ändern, was allerdings genau der Hintersinn derartiger Kritik und die Absicht dieser Kritiker ist.
Das Say'sche Theorem ist ein sophistischer Trick

Einen absichtlich herbeigeführten Fehlschluss wie beim Say'schen Theorem bezeichnet man als Sophismus.
Das Say'sche Theorem behauptet, dass es grundsätzlich keine Absatzkrisen geben könne. Begründet wird diese These damit, dass jede Produktion immer ein Einkommen in gleicher Höhe schafft, so dass es also nie einen Mangel an Kaufkraft und Nachfrage geben könne. Dieses Einkommen werde entweder für den Konsum ausgegeben oder gespart und damit investiert (Einkommen = Konsum + Investition).
Die Begründung des Theorems ist lachhaft: "Einkommen gleich Produktion" ist eine Tautologie, weil in makroökonomischer Sicht die Produktion das Einkommen schafft und alles Einkommen aus der Produktion resultiert.
Nun hat aber überhaupt niemand behauptet, dass die Absatzkrisen dadurch entstünden, dass kein genau mit der Höhe der Produktion identisches Einkommen geschaffen würde. Einen selbsterfundenen Einwand zu widerlegen und die These damit für bewiesen zu erklären, ist ein alter und dummer Trick, auf den außer in den VWL-Vorlesungen nur noch in einem Kindergarten jemand reinfallen wird. Das Einkommen passt genau zum Umfang der Produktion - Menschen sind aber arbeitslos, weil die Produktion weit unter dem Produktionspotenzial liegt.
Wie in der VWL üblich, ist der Ausgangspunkt der Argumentation genau das, was erst zu beweisen wäre, also die volle Auslastung des Produktionspotentials ohne Rücksicht auf den Absatz der Produkte. So haben wir immer Vollbeschäftigung und dabei entsteht auch ein Vollbeschäftigungseinkommen in der Ökonomie, mit dem alle erzeugten Produkte abgesetzt werden können. Man unterstellt einfach, dass die Unternehmen den Umfang der Produktion bestimmen und zum Zweck der Gewinnmaximierung das Produktionspotential immer voll auslasten, ohne sich für den Absatz der so produzierten Güter zu interessieren. Im Modell der VWL besteht schließlich grundsätzlich Kapitalmangel, der durch Produktion behoben werden kann. Auch ohne jeden Konsumenten wäre die Vollbeschäftigung zum Zweck der Erzeugung von immer noch mehr Kapital denkbar. Nur wegen des immerwährenden Kapitalmangels kann ohne Ausnahme mit voller Auslastung des Produktionspotentials produziert werden, weil ein Absatzrückgang der Konsumgüter durch eine erhöhte Kapitalgüterproduktion ausgeglichen werden kann. Schlimmstenfalls müssen die Unternehmen das von den Konsumenten gesparte Geld als Kredit für die Finanzierung ihrer Kapitalerweiterung aufnehmen, die bei Kapitalmangel immer rentabel ist, wenn die Zinsen sich laut Modell nach Angebot und Nachfrage zur Finanzierung dieser Investitionen richten. Bei der so garantierten Vollbeschäftigung kann dann immer jeder Arbeit finden, der keine unverschämten Lohnforderungen stellt, und Massenarbeitslosigkeit ist freiwillig, so beweisen es die Professoren.

Wie die Zusammenhänge wirklich sind, zeigt die Abbildung des Wirtschaftskreislaufs nach Keynes: Die Haushalte bestimmen durch ihre Nachfrage den Umfang der Produktion von Konsumgütern und sie erhalten ein Faktoreinkommen in der Höhe dieser Produktion. Die Haushalte könnten also ihren Konsum maximieren und würden dabei ihr Einkommen maximieren. Aber die Haushalte wollen einen bestimmten Teil ihres Einkommens sparen. Sie haben zu diesem Zweck nur die Möglichkeit, ihren Konsum einzuschränken, wodurch die Produktion unter das Produktionspotential fällt.
Die neoklassische Theorie hat einfach unterstellt, dass jedes Sparen am Konsum zu Ersparnissen führe, die dann von den Haushalten am Kapitalmarkt angeboten würden. Ein größeres Angebot an Ersparnissen würde nun die Zinsen am Kapitalmarkt senken und die Investitionen steigen lassen, bis alle Ersparnisse der Haushalte von den Unternehmen für Investitionen nachgefragt werden. Es entstehen jedoch durch das Sparen makroökonomisch keine Ersparnisse, die an einem Kapitalmarkt angeboten werden können, das ist ein mikroökonomischer Trugschluss, auf den wir später noch zurückkommen. Zunächst einmal bewirkt der Konsumverzicht nur einen sinkenden Absatz von Konsumgütern durch die Unternehmen, eine sinkende Produktion dieser Konsumgüter und damit sinkende Einkommen der Haushalte. Das Sparen führt also nicht zu Ersparnissen, sondern zu Einkommensverlusten der Haushalte.
Natürlich könnte die Geldpolitik zum Ausgleich des Sparens der Haushalte am Konsum den Realzins senken und so die Unternehmen zu höheren Investitionen veranlassen. Die Neoklassik kennt allerdings keinen Realzins, weil das Geld ja angeblich neutral sei. Die Neoklassik kennt auch keine negativen Renditen für Investitionen, die sich wie in der Weltwirtschaftskrise 1929-33 durch die Deflation der Preise ergeben. Bei negativen Renditen durch Deflation ist es für Unternehmen sinnvoll, auf Investitionen zu verzichten oder diese wenigstens zu verschieben, bis die Deflation von der Geldpolitik beendet wird. Nur aus dem Grund, weil die Neoklassik die Preise und das Geld einfach nicht beachtet, sind im neoklassischen Modell die Renditen für Investitionen wegen der Annahme einer grundsätzlichen Knappheit des Kapitals immer positiv. Ohne Beachtung des Geldes und der Preise wären also Investitionen immer rentabel. Wir haben aber eine Ökonomie mit Geld und in dieser Ökonomie reicht es aus, dass die Zentralbank zum Beispiel den kurzfristigen Zins über die Rendite der Investition anhebt. Dann findet die Investition nicht statt, das Geld für die Investition wird nicht geliehen oder falls es aus vorhandenen Rücklagen vorhanden sein sollte, für die hohen Zinsen verliehen. Mit dem Ausfall der Investition kommt es zu einem entsprechenden Ausfall der Produktion und damit sinken die Einkommen der Haushalte.
Nach einer Erhöhung der Zinsen durch die Zentralbank kann es also geschehen, dass die Unternehmen ihre Investition einschränken. Die Unternehmen entscheiden über die Investition und bestimmen dadurch die Ersparnis der Haushalte, die nur mit der Investition entsteht und mit dieser identisch ist. Wenn die Haushalte wegen des Rückgangs ihrer Ersparnisse durch die Investitionskürzung der Unternehmen verstärkt am Konsum sparen, werden die Unternehmen ihre Investition und damit die Ersparnis der Haushalte noch weiter reduzieren, die Produktion sinkt noch tiefer unter das Produktionspotential und damit fallen die Einkommen der Ökonomie. Es handelt sich also um einen sich selbst verstärkenden Effekt von Konsumeinschränkung wegen des Sparens und Investitionskürzung wegen der sinkenden Konsumnachfrage mit dem Paradoxon des Sparens, dass die Ersparnis tatsächlich sinkt, je härter gespart wird.
Während eines Booms sind Nachfrage, Produktion und Einkommen hoch. Mit der Auslösung einer Absatzkrise durch die Zinserhöhungen der Notenbank brechen Nachfrage, Produktion und Einkommen gemeinsam ein. Bei einer Absatzkrise liegen Nachfrage, Produktion und Einkommen unter dem Produktionspotenzial der Ökonomie. Es sind Fabriken und Geschäfte nicht ausgelastet und Arbeiter erwerbslos. Die Einkommen sind zwar so hoch wie die Produktion, aber nicht so hoch wie bei einer optimalen Auslastung des Produktionspotenzials. In der Krise wird wenig produziert und wenig verdient, in einem Boom wird viel produziert und viel verdient.
Offensichtlich ist die Identität von Produktion und Einkommen kein hinreichender Grund dafür, dass die Produktion das Produktionspotenzial optimal auslasten würde.
Die Auslastung des Produktionspotenzials wird durch die Geldpolitik gesteuert, die entweder mit hohen Zinsen und einer restriktiven Kreditvergabe die Nachfrage abwürgen kann oder mit niedrigen Zinsen bei einer expansiven Kreditvergabe die Nachfrage steigen lässt. Die Geld- oder Kreditpolitik steuert die Nachfrage und die (Unter-)Auslastung des Produktionspotenzials; an der Nachfrage orientieren sich Produktion und Einkommen.
Geldpolitik -> Nachfrage -> Produktion = Einkommen
Erwarten Sie jetzt aber bitte nicht, dass die sogenannte Wirtschaftswissenschaft Ihnen eine verbindliche Formulierung des Say'schen Theorems vorweist. Damit würde man es den Kritikern zu einfach machen und deshalb finden wir weder eine verlässliche Darstellung des Theorems, noch eine Stellungnahme der VWL zu den schon zu Lebzeiten von Say durch Malthus und Sismondi erhobenen Einwänden oder zu den seitdem von zahllosen Autoren dargelegten Widerlegungen. Es ist dreister Schwindel und Betrug.
Der historische Anlass für das Say'sche Theorem war vor 200 Jahren die mörderische deflationäre Depression, mit der die Bank von England nach dem Krieg gegen Napoleon das während des Krieges stark gestiegene Niveau der Löhne und Preise in England wieder herunterbrach. Ricardo hat dann vorbildlich für die nachfolgenden VWL-Professoren die Möglichkeit von Absatzkrisen wider besseren Wissens grundsätzlich mit dem Say'schen Theorem geleugnet.
Die post-napoleonische Depression
Ein Komitee des Parlaments sollte die einfache Frage klären, warum der Krieg gegen Napoleon in England die Preise hatte steigen lassen:
… in February 1810, the House of Commons set up a Select Committee on the High Price of Gold Bullion to investigate why it had risen during the Napoleonic Wars.
200th Anniversary of the 1810 Bullion Committee By Timothy Green
Die Antwort könnten wir ohne weitere Untersuchungen geben, aber es ging selbstverständlich um ein ganz anderes Anliegen. Das Komitee sollte der Öffentlichkeit die Sache so darstellen, als habe die Bank von England fahrlässig zu viele Banknoten herausgegeben, wofür sie von David Ricardo in der Presse scharf kritisiert wurde, aber man müsse jetzt nur den Banknotenumlauf reduzieren und schon sei die Inflation der Kriegsjahre überwunden. Milton Friedmans Geldmengenstuss war eine Neuauflage von Ricardo.
Selbstverständlich konnte die Bank von England nicht einfach so weniger Banknoten in Umlauf bringen, sondern sie musste mit dem Ziel, weniger Banknoten ausgeben zu können, ihren Diskontsatz stark erhöhen und mit der restriktiven Kreditpolitik eine brutale Absatzkrise auslösen. Absatzkrise und mörderische Massenarbeitslosigkeit ließen die Löhne und Preise wieder auf das Vorkriegsniveau sinken und damit auch den Geldumlauf.
Wen es interessiert, der kann im Internet die Schriften von Ricardo nachlesen, in denen er diese Deflationspolitik propagiert hat:
David Ricardo, The Works and Correspondence of David Ricardo, Vol. 3 Pamphlets and Papers 1809-1811
Diese brutale Absatzkrise hat Ricardo maßgeblich politisch unterstützt und gleichzeitig mit dem Say'schen Theorem geleugnet. Nach Ricardos Vorbild werden Absatzkrisen und unfreiwillige Massenerwerbslosigkeit bis heute von Professoren vor ihren Studenten und dem Publikum für überhaupt völlig unmöglich erklärt. Das ist Volkswirtschaftslehre!
Die Deflationspolitik der Bank von England verursachte in ganz Europa eine mörderische Depression. David Ricardo erklärte auf dem Höhepunkt der Deflationskrise, dass er eine derart restriktive Politik der Bank von England nicht gefordert habe. Außerdem behauptete Ricardo plötzlich, Arbeitslosigkeit sei eine Folge des technischen Fortschritts, weil mit Kapital aus dem Lohnfond Maschinen gekauft würden und deshalb aus Kapitalmangel weniger Arbeiter bezahlt werden könnten. Bis dahin hatte er den Fortschritt der Technik mit Say immer für problemlos gehalten, weil ja jede Produktion sich ihre Nachfrage schaffe und der Steigerung der Produktion durch mehr Maschinen und bessere Technik keine Grenze von Seiten der Absatzmöglichkeiten gesetzt wäre.
Die Panik von 1819 in den USA
In den USA hatte der Britisch-Amerikanische Krieg von 1812-14 mit hohen Kosten die Konjunktur belebt und nach Kriegsende sollte gespart werden. Zusätzlich fielen durch die Depression in England und Europa die Exporte der USA.
Austrian school economists view the nationwide recession that resulted from the Panic of 1819 as the first failure of expansionary monetary policy. This explanation is based on the Austrian theory of the business cycle. Government borrowed heavily to finance the War of 1812, which caused tremendous strain on the banks’ reserves of specie, leading to a suspension of specie payments in 1814, and then again during the recession of 1819-1821, violating contractual rights of depositors. The suspension of the obligation to redeem greatly spurred the establishment of new banks and the expansion of bank note issues, and this inflation of money encouraged unsustainable investments to take place. It soon became clear the monetary situation was threatening, and the Second Bank of the United States was forced to call a halt to its expansion and launch a painful process of contraction. There was a wave of bankruptcies, bank failures, and bank runs; prices dropped and wide-scale urban unemployment began. By 1819, land measures in the U.S. had also reached 3,500,000 acres (14,200 km2), and many Americans did not have enough money to pay off their loans.
Die Österreichische Schule macht für die Depression wie üblich nicht die Kreditrestriktion verantwortlich, sondern die vorausgegangene Expansion, die sich aber vor allem in Kriegszeiten schlecht vermeiden lässt. Ohne eine expansive Geldpolitik hätte es die Belebung der Konjunktur nicht gegeben und die Preise wären nicht gestiegen. Andererseits ist es nur im Interesse der Rentiers, wenn nach Kriegen oder nach einem Boom eine deflationäre Depression inszeniert wird auf Kosten der breiten Bevölkerung, statt die Inflation der Währung gegen das Gold oder gegen ausländische Währungen mit einem neuen Wechselkurs zu berücksichtigen.
Jedenfalls gibt es die Absatzkrisen im Gegensatz zum Say'schen Theorem wirklich und sie sind keine unerklärbaren und vor allem keine unvermeidbaren Phänomene, sondern das Ergebnis absichtlich restriktiver Geldpolitik - ob eine zuvor expansive Geldpolitik als fehlerhaft gescholten wird oder nicht.
Thomas Jefferson, der dritte Präsident der Vereinigten Staaten von 1801 bis 1809, beschrieb die Folgen der Deflationspolitik im Jahr 1819 so:
The paper bubble is then burst. This is what you and I, and every reasoning man, seduced by no obliquity of mind or interest, have long foreseen; yet its disastrous effects are not the less for having been foreseen. We were laboring under a dropsical fulness of circulating medium. Nearly all of it is now called in by the banks, who have the regulation of the safety-valves of our fortunes, and who condense and explode them at their will. Lands in this State cannot now be sold for a year’s rent ; and unless our legislature have wisdom enough to effect a remedy by a gradual diminution only of the medium, there will be a general revolution of property in this State. Over our own paper and that of other States coming among us, they have competent powers ; over that of the bank of the United States there is doubt, not here, but elsewhere.
Thomas Jefferson: To John Adams, Esq. Monticello, November 7, 1819.
Die Banken konnten mit einer expansiven Kreditpolitik in Kriegszeiten die Wirtschaft zum Aufblühen bringen, was selbstverständlich mit steigenden Preisen verbunden war, und nach Kriegsende mit Unterstützung der Rentiers und Kriegsspekulanten durch restriktive Kreditpolitik dafür sorgen, dass die Spekulanten nun mit ihrem Geld die Ländereien und Sachwerte billigst von den ruinierten Eigentümern erwerben konnten. Die Spekulanten brauchten nur zu wissen, wie die Geldpolitik Boom oder Krise herbeiführt. Die Banken ließen nach Kriegsende die Kredite auslaufen, verlängerten also die Kredite nicht und vergaben kaum neue Kredite an Nachschuldner, und schon waren die besten Ländereien und Sachwerte zu Spottpreisen zu kaufen, weil deren Eigentümer sie dringend zu Geld machen mussten, da die Banken kaum Kredit vergaben.
Auszug aus „On the Principles“ von David Ricardo
Es ist kaum zu glauben, wie schwachsinnig die Argumente eines so gerühmten Ökonomen zu dem wichtigen Thema der Absatzkrisen waren.
Hier ein längeres Zitat von David Ricardo als Beispiel:
M. Say has, however, most satisfactorily shewn, that there is no amount of capital which may not be employed in a country, because demand is only limited by production. No man produces, but with a view to consume or sell, and he never sells, but with an intention to purchase some other commodity, which may be immediately useful to him, or which may contribute to future production. By producing, then, he necessarily becomes either the consumer of his own goods, or the purchaser and consumer of the goods of some other person. It is not to be supposed that he should, for any length of time, be ill-informed of the commodities which he can most advantageously produce, to attain the object which he has in view, namely, the possession of other goods; and, therefore, it is not probable that he will continually produce a commodity for which there is no demand.
There cannot, then, be accumulated in a country any amount of capital which cannot be employed productively, until wages rise so high in consequence of the rise of necessaries, and so little consequently remains for the profits of stock, that the motive for accumulation ceases. While the profits of stock are high, men will have a motive to accumulate. Whilst a man has any wished-for gratification unsupplied, he will have a demand for more commodities; and it will be an effectual demand while he has any new value to offer in exchange for them. If ten thousand pounds were given to a man having £100,000 per annum, he would not lock it up in a chest, but would either increase his expenses by £10,000; employ it himself productively, or lend it to some other person for that purpose; in either case, demand would be increased, although it would be for different objects. If he increased his expenses, his effectual demand might probably be for buildings, furniture, or some such enjoyment. If he employed his £10,000 productively, his effectual demand would be for food, clothing, and raw material, which might set new labourers to work; but still it would be demand.
Productions are always bought by productions, or by services; money is only the medium by which the exchange is effected. Too much of a particular commodity may be produced, of which there may be such a glut in the market, as not to repay the capital expended on it; but this cannot be the case with respect to all commodities; the demand for corn is limited by the mouths which are to eat it, for shoes and coats by the persons who are to wear them; but though a community, or a part of a community, may have as much corn, and as many hats and shoes, as it is able or may wish to consume, the same cannot be said of every commodity produced by nature or by art. Some would consume more wine, if they had the ability to procure it. Others having enough of wine, would wish to increase the quantity or improve the quality of their furniture. Others might wish to ornament their grounds, or to enlarge their houses. The wish to do all or some of these is implanted in every man's breast; nothing is required but the means, and nothing can afford the means, but an increase of production. If I had food and necessaries at my disposal, I should not be long in want of workmen who would put me in possession of some of the objects most useful or most desirable to me.
David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, chap. 21.2-21.3
Ich denke, Argumente gegen diese dreisten Behauptungen wider besseren Wissens sind völlig überflüssig. Dass solche Thesen von der VWL gestützt werden, indem man das Geld bis heute in den neoklassischen Modellen unwidersprochen nur als Geldschleier und als Tauschmittel ohne Einfluss auf die Realwirtschaft behandelt, ist ein Skandal. Jeder Professor redet sich selbstverständlich damit heraus, dass er ja nur die neoklassischen Modelle lehre und dass diese eben von Say, Ricardo und Mill beeinflusst seien und in diesen Modellen gilt das Geld als neutral.
Zumindest müssten die Studenten darüber aufgeklärt werden, welche falschen Vorstellungen mit diesen Modellen verbreitet werden und dass diese Modelle für die Realität völlig unbrauchbar und eine gezielte Irreführung des Publikums sind. Stattdessen werden die Studenten mit den kompliziertesten mathematischen Kurvendiskussionen noch gezwungen, im Sinn dieser Modelle zu denken und zu argumentieren und diese Modelle sogar für passend und zutreffend zu halten.
Das Say'sche Theorem in der aktuellen VWL
Ulrich van Suntum schreibt in seinem Lehrbuch zur VWL:
Das Saysche Theorem besagt im Prinzip folgendes: Wer am Markt irgendein Gut anbietet, tut dies aus keinem anderen Grund als dem, daß er Einkommen erzielen und damit selbst irgendwelche anderen Güter kaufen will. Besonders deutlich wird das, wenn man für einen Moment einmal das Geld außer Betracht lässt und sich eine reine Tauschwirtschaft vorstellt.
(Ulrich van Suntum „Die unsichtbare Hand“, 3. Auflage, 2005, S. 104/105)
So lächerlich wird heute immer noch argumentiert! Krisen haben monetäre Ursachen, aber die Leser sollen das Geld einmal außer Betracht lassen. Dann kann man behaupten, dass es niemals eine Absatzkrise geben könne, also ohne Geld und so. Da tauscht halt ein jeder Mensch seine Ware, die er hergeben möchte, gegen ein anderes Gut, das er dafür lieber hätte. Offensichtlich führt dann ein erhöhtes Güterangebot zu einer erhöhten Nachfrage nach anderen Gütern. Jetzt braucht van Suntum nur noch so zu tun (S. 105), als ob dies auch für eine Ökonomie mit Geld gelten würde:
An diesem grundlegenden Prinzip ändert sich nach klassischer Auffassung auch dann nichts, wenn zur Vereinfachung der Tauschvorgänge Geld benutzt wird.
Mit dem Hinweis „nach klassischer Auffassung“ übernimmt van Suntum für den Schwindel selber keine Verantwortung, denn er lehrt ja nur die Lehre der Klassiker. Ob das dann stimmt, ist kein Thema in seinem Buch, der Leser soll aber glauben, dass das Theorem stimmt. Dazu stellt van Suntum gleich noch das Sparen und die Kreditvergabe falsch dar, aber wieder nicht ohne den Hinweis auf die „klassische Auffassung“ (ebenda):
Das gilt nach klassischer Auffassung selbst dann, wenn gespart wird. Wer seine Einnahmen zur Bank bringt, statt sie für Güterkäufe zu verwenden, verringere damit nämlich nur scheinbar die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Denn offenbar liegt es im Interesse der Bank, das Geld auszuleihen, in erster Linie an die Unternehmen. Dadurch aber wird die Ersparnis wiederum nachfragewirksam, denn die Unternehmen fragen mit Hilfe des geliehenen Geldes Investitionsgüter nach.
Diese Darstellung der Kreditvergabe müsste jetzt sogar zu einer endlosen Ankurbelung der Nachfrage führen, denn sobald die Unternehmen mit Hilfe des geliehenen Geldes Güter kaufen und bezahlen, liegt das Geld ja schon wieder auf dem Bankkonto und muss nach der zitierten Auffassung wieder einen weiteren Kreditnehmer finden.
Offensichtlich ist diese Darstellung der Kreditvergabe falsch. Die Banken brauchen kein vorher eingezahltes Geld, um einen Kredit zu vergeben, weil bei der Kreditvergabe und spätestens mit der Bezahlung eine Einlage auf dem Konto des Geldempfängers entsteht. Die Kreditvergabe ist immer ein Akt der Geldschöpfung, was selbstverständlich auch die Klassiker schon gewusst haben mussten, aber systematisch und absichtlich falsch gelehrt haben. Wieder korrigiert van Suntum nicht, sondern vertieft die völlig falsche Darstellung weiter, dass es über den Zins zu einem Gleichgewicht von Ersparnis und Investition am Kapitalmarkt käme (ebenda):
Der Mechanismus des Zinses bringt dabei Angebot und Nachfrage von Leihkapital stets zum Ausgleich. Wird beispielsweise mehr gespart, als die Unternehmen investieren wollen, so muß der Zins sinken. Dies senkt nach klassischer Auffassung den Anreiz zu sparen, und es erhöht gleichzeitig den Anreiz zu investieren. Umgekehrt würde ein Überschuß der Investitionsnachfrage über das Angebot an Sparkapital den Zinssatz erhöhen, bis der Kapitalmarkt wieder im Gleichgewicht ist.
Anschließend erörtert van Suntum noch das Problem des Hortens (das sich nur aus dieser falschen Darstellung der Kreditvergabe ergeben würde), dass gespartes Geld nicht zur Bank gebracht wird, die es verleiht. Weil die Banken aber niemals gespartes Geld verleihen, sondern mit jedem Kredit zusätzliches Geld schöpfen, sind auch die Ausführungen zur Geldhortung ohne jeden Bezug zur ökonomischen Realität.
Auf Seite 106 geht es dann mit der Krisentheorie von Marx weiter, ohne dass die mit der Darlegung dieser „klassischen Auffassung“ verbundenen falschen Darstellungen ökonomischer Zusammenhänge abschließend wieder korrigiert würden. Auf eine zutreffende Darstellung des Sparens und der Kreditgeldschöpfung könnte der VWL-Student bis zu seiner letzten Prüfung vergebens warten, aber er hat in aller Regel nichts davon bemerkt und ist völlig in den falschen Vorstellungen gefangen.
Geldschöpfung und Kredit
Wegen der falschen Lehren der Ökonomen hat die Bevölkerung irrige Vorstellungen über Geld und Kredit. Selbstverständlich wissen die zuständigen Leute von den richtigen Zusammenhängen, sie hängen es aber nicht an die große Glocke. So erklärte die Bundesbank die Geldschöpfung einmal für Schüler in einem Satz (inzwischen wurde der Text der aktuellen Schülerbroschüre zum Geld wesentlich verändert und die Aussage ist wieder verwirrend, daher keine Quellenangabe):
Hauptquelle der Geldschöpfung ist heute die Kreditgewährung der Geschäftsbanken (aktive Geldschöpfung): Dem Kreditnehmer wird ein Sichtguthaben (Sichteinlagen) in Höhe des aufgenommenen Kredites eingeräumt, wodurch die gesamtwirtschaftliche Geldmenge unmittelbar steigt.
Jede Kreditvergabe ist für das Bankensystem eine Bilanzverlängerung. Es wird eine Forderung auf Termin auf der Habenseite verbucht und im Soll erhält der Kreditnehmer in der Höhe der Kreditsumme eine Forderung an die Bank als Sichteinlage auf seinem Konto. Häufig wird dieser Vorgang als „Geldschöpfung aus dem Nichts“ bezeichnet, weil das Buchgeld, über das der Kreditnehmer jetzt verfügen kann, einfach als Gegenposition zum abgeschlossenen Kreditvertrag gutgeschrieben wird.
Für diese Gutschrift benötigt die Bank keine Einzahlung von gesparten Kundengeldern auf anderen Kundenkonten, um dies noch einmal ganz deutlich zu betonen. Daher sind alle „klassischen Auffassungen“ über ein Weiterverleihen gesparter Gelder durch die Banken oder gar ein Gleichgewicht von angebotenen Ersparnissen und nachgefragten Krediten bei einem bestimmten Zinssatz am Kapitalmarkt ein völliger Humbug und ausgemachter Schmarren.
Bei der Kreditvergabe erzeugt die Bank das zugehörige Guthaben für den Kreditnehmer. Dieses Guthaben ist die Kundeneinlage bei der Bank, die dem Kunden verliehen wurde. Sobald der Kreditnehmer sein Guthaben für Zahlungen verwendet, wechselt das Buchgeld von seinem Konto auf die Konten der Zahlungsempfänger.
Hat der Empfänger des Geldes sein Konto bei einer anderen Bank, dann verschuldet sich die Bank des Zahlers bei der Zentralbank oder direkt bei der Bank des Empfängers, die diesem den Betrag auf seinem Konto gutschreibt. Weil die Banken sich auch gegenseitig Zinsen zahlen müssen, ist jede Bank daran interessiert, Kundeneinlagen zu erhalten. In der Regel zahlt die Bank dem Kunden weniger Zins als einer anderen Bank und dieser zahlt sie weniger Zins als sie von ihrem Kreditnehmer erhält. Die Zinsdifferenz ist der Bruttoertrag und das Geschäftsziel der Bank. Der Zins für Zentralbankgeld kann sehr unterschiedlich sein, so dass die Überweisungen von einer Bank zur anderen Geschäftsbank bevorzugt über die Zentralbank mit dort geliehenem Zentralbankgeld oder direkt und über Dachorganisationen zum Clearing zwischen den Geschäftsbanken abgewickelt werden.
Für die sogenannte Geldschöpfung "aus dem Nichts" benötigt die Bank einen Schuldner mit Sicherheiten, der diese der Bank für den Kredit verpfändet. Daher ist die Aussage womöglich irreführend, dass die Bank das Geld "aus dem Nichts" schaffen würde, denn sie braucht dafür die Sicherheiten des Kreditnehmers, nur eben keine gesparten Gelder anderer Bankkunden. Im Prinzip ist die Buchgeldschöpfung ein ganz privates Geschäft zwischen der Bank und ihrem Schuldner, das Buchgeld ist eine Forderung des Kreditnehmers an die Bank. Die Bank prüft und beglaubigt mit dem Kreditvertrag die Sicherheiten des Kreditnehmers stellvertretend für die gesamte Ökonomie, in der dieser Kreditnehmer dann mit dem Buchgeld der Bank zahlen kann, und kümmert sich um die Tilgung. Ganz grundsätzlich ist aber der Vorgang der Buchgeldschöpfung nur eine Verbriefung der haftenden Sicherheiten des Kreditnehmers, resultierend in umlauffähigem Geld. Man könnte sich die Bank auch einfach als Notar vorstellen, der dem Eigentümer eines Grundstücks im Wert von z. B. 2 Mio. Geld, der 1 Mio. Geld für irgendeine Zahlung benötigt, die entsprechende Besicherung auf 1 Mio. umlauffähigen Geldzetteln bescheinigt: "Dieser Zettel hat den Wert von 1 Geld besichert mit dem Grundstück (Adresse, Besitzer etc.)". Weil das zu umständlich wäre, tragen Geschäftsbanken für den Kredit Buchgeld auf dem Kundenkonto ein und zahlen dem Kreditnehmer auf Wunsch auch Zentralbanknoten aus, die sich die Bank gegebenenfalls zur Auszahlung für den Kunden von der Zentralbank leiht.
Wenn mit Geld “bezahlt” wird, dann wird im Prinzip eine Forderung übertragen. Die Tilgung einer durch Kauf entstandenen Verbindlichkeit kann immer nur durch einen Kauf des Gläubigers bei einem Schuldner erfolgen, so dass sich die beiden Forderungen aufheben. Solange der Gläubiger, der Geld verdient hat, dieses Geldvermögen spart (egal ob bar oder auf einem Konto oder als Anleihe), kann die Schuld nicht wirklich getilgt, sondern nur auf einen anderen Nachschuldner übertragen werden. Zahlt jemand seine Schuld mit Bargeld, ist der Nachschuldner die Zentralbank. Überweist jemand das Geld, ist der Nachschuldner die Geschäftsbank. Durch Bezahlen erlischt nur mikroökonomisch die Schuld des jeweils Bezahlenden, makroökonomisch hat sich an den Schulden = Geldvermögen damit nichts geändert.
Banken können auch direkt zum Beispiel Gold oder Wertpapiere ankaufen und dem Verkäufer den Kaufbetrag auf sein Konto gutschreiben. Auch hier handelt es sich um eine Geldschöpfung, es entsteht Buchgeld. Weder für die Kreditvergabe noch für den Ankauf von Edelmetall oder Wertpapieren (oder einer Kiste Sekt für den Bankdirektor) durch die Gutschrift von Buchgeld auf dem Kundenkonto ist die Bank von vorher eingezahlten Kundengeldern abhängig.
Kunden können ihre Guthaben auf eine andere Bank überweisen oder bar auszahlen lassen. Bei einer Überweisung an eine andere Bank, muss die Bank für den Betrag der Zentralbank oder direkt dieser anderen Bank Zinsen zahlen. Will der Kunde sein Geld bar, dann muss die auszahlende Bank sich das Bargeld von der Zentralbank gegen Zins leihen. Die Zentralbank kann keiner Bank das mit den üblichen Sicherheiten geforderte Bargeld verweigern, weil vielleicht die "Geldmenge" damit eine künstliche Begrenzung übersteigen würde, sondern die Notenbank müsste den Leitzins erhöhen, bis weniger Bargeld nachgefragt wird. Es gibt also keine Geldmengenpolitik, sondern nur Zinspolitik, was auch immer die VWL-Professoren den Studenten einreden.
Das Zentralbankgeld und der angebliche Geldschöpfungsmultiplikator
Die Zentralbank druckt so viel Bargeld, wie die Geschäftsbanken haben wollen, und leiht es diesen gegen Zins und Sicherheiten. Die Banken reichen zum Beispiel Staatsanleihen als Pfand und Sicherheit bei der Zentralbank ein und erhalten dafür das Zentralbankgeld für die sogenannten Mindestreserven und für die Barauszahlungen an ihre Bankkunden. In keinem Fall wird die Zentralbank wegen der Überschreitung irgendeines Geldmengenzieles die Herausgabe von ZB-Geld an die Geschäftsbanken einschränken, sondern sie wird über eine Erhöhung der Zinsen die Nachfrage für die Geschäftsbanken verteuern.
Zur Bekämpfung der Inflation erhöht die Zentralbank ihre Zinsen für das Zentralbankgeld, weil dann die Geschäftsbanken für ihre Kundeneinlagen die Zinsen erhöhen werden und vor allem für ihre Kreditnehmer. Mit steigenden Zinsen werden weniger Kredite bei den Geschäftsbanken nachgefragt, es entsteht weniger Buchgeld, dadurch wird weniger gekauft, die Einnahmen der Bevölkerung gehen zurück und damit schließlich auch der Bargeldumlauf.
Die sogenannten Geldmengen werden von der Zentralbank nur indirekt über ihre Zinspolitik und deren Auswirkungen auf Konjunktur und Beschäftigung beeinflusst. Eine direkte Geldmengensteuerung, die den Zins und die Konjunktur unbeschadet lässt, gibt es nicht. Die Inflationsbekämpfung muss immer eine Rezession auslösen oder wenigstens restriktiv auf Güternachfrage, Wachstum und Beschäftigung wirken.
Die beliebte Diskussion über Bareinzahlungen und das angebliche fraktional reserve banking vor allem in den USA ist nur ein Verwirrspiel für das Publikum. Die Geschäftsbank verleiht nicht ein Vielfaches Ihrer eingezahlten 100 Dollar, weil die Banken für die Kreditvergabe überhaupt keine vorher eingezahlten Kundeneinlagen brauchen. Das Zentralbankgeld für gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserven oder Barauszahlungen leiht sich das Bankensystem nach Bedarf von der Zentralbank. In keinem Fall ist eine Kreditvergabe davon abhängig, ob gerade noch genug Zentralbankgeld in der Geschäftsbank vorhanden ist, da schaut niemand vorher im Tresor nach.
Der angebliche Geldschöpfungsmultiplikator
Die Bank von England hat vorbildlich und ganz aktuell den populären Irrtümern über einen Geldschöpfungsmultiplikator widersprochen:
• This article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercial banks making loans.
• Money creation in practice differs from some popular misconceptions — banks do not act simply as intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and nor do they ‘multiply up’ central bank money to create new loans and deposits.
• The amount of money created in the economy ultimately depends on the monetary policy of the central bank. In normal times, this is carried out by setting interest rates. The central bank can also affect the amount of money directly through purchasing assets or ‘quantitative easing’.
Bank of England, Quarterly Bulletin 2014 Q1: Money creation in the modern economy (PDF)
Sie sollten sich die PDF abspeichern, denn wer weiß, wie lange das online verfügbar ist. Viele VWL-Professoren, die noch immer diesen Geldschöpfungsmultiplikator lehren, sind damit öffentlich als Narren entlarvt und werden sich das nicht gefallen lassen wollen.
Warum Ihr gespartes Geld nicht noch einmal verliehen wird
Die verbreitete Vorstellung, dass die Banken das gesparte Geld ihrer Kunden verleihen würden, ist ein lehrreiches und lustiges Beispiel für die falschen Überzeugungen, die aus dem mikroökonomischen Erleben und Denken der Menschen entstehen und womöglich in einer mikroökonomischen Fundierung falscher makroökonomischer Thesen enden.
Die mikroökonomische Sicht: Wenn Sie Geld ausgeben, dann ist es weg; nur wenn Sie das Geld nicht ausgeben, kann es auf Ihrem Konto liegen und von der Bank verliehen sein. Der Trugschluss daraus, dass die Bank mehr Geld verleihen könne, wenn Sie mehr sparen würden, und dass die Banken Ersparnisse verleihen würden.
Die makroökonomische Sicht: Wenn Sie Geld ausgeben, dann ist es zwar für Sie persönlich weg, aber es liegt nur auf einem anderen Konto. Die Bankeinlagen werden durch das Sparen nicht mehr und durch das Ausgeben nicht weniger und selbst die Barauszahlung der Einlagen ist kein Problem, weil dabei praktisch ein Kredit der Notenbank an die Stelle der Kundeneinlage tritt.
Bankeinlagen entstehen nicht durch
"Sparen", wie das Publikum in seiner mikroökonomischen Denkweise meint und sogenannte Nobelpreisträger der Ökonomie behaupten. Die Vorstellung, durch Geldsparen könne in einer
Volkswirtschaft mehr Geld verliehen werden, ist das Resultat einer absurden mikroökonomischen Betrachtung, die nur den eigenen Geldbeutel und das eigene Konto im Blick hat.
Wie wieder der kurze Blick in das einschlägige Lehrbuch von Gregory Mankiw zeigt, ist der alte Unsinn der
Klassiker noch immer aktuell:
Der Kreditmarkt. Der Zinssatz passt sich an, um das Angebot an und die Nachfrage nach Kreditmitteln in
einer Volkswirtschaft in Übereinstimmung zu bringen.
Mankiw: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 2012, S. 693 Schaubild 26-1
Das Angebot der Mankiwschen "Kreditmittel" stamme von "denjenigen Menschen, die einen (derzeit
überzähligen) Teil ihres Einkommens sparen und verleihen wollen", müssen wir da wieder lesen. Mit den "Kreditmitteln" ist also erspartes Geld gemeint:
...z.B. wenn ein Haushalt eine Bankeinlage macht, die die Bank wiederum zur Kreditvergabe
verwendet.
Mankiw, ebenda, S. 692
Vielleicht könnte mal jemand dem Gregory Mankiw erklären, dass er von Ökonomie jedenfalls keine Ahnung hat
und seine begeisterten Leser auch nicht.
Ob zusätzliche Kredite vergeben werden und dabei zusätzliche Einlagen entstehen, hängt nur davon ab, ob das Zinsniveau und die Geschäftsaussichten die potentiellen Kreditnehmer (mit ausreichenden Sicherheiten) veranlassen können, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Hohe Zinsen senken die Verschuldungsbereitschaft und sind schlecht für die Geschäftsaussichten, denn mit den Krediten wäre zusätzliche Güternachfrage entstanden. Über die Kreditvergabe kann das Bankensystem aus Geschäftsbanken und der Zentralbank die Konjunktur steuern.
Die falsche Vorstellung des Publikums, dass sein gespartes Geld anschließend von der Bank wieder verliehen werde und somit zu zusätzlichen Investitionen oder Ausgaben für den Konsum führe, ist die Ursache, warum das Publikum die konjunkturschädigende Wirkung des mit Hochzinspolitik verstärkten Sparens nicht versteht. Daher wird diese falsche Auffassung in Schulen, Universitäten und den Massenmedien heute noch ständig bestärkt. Dabei ist die Wahrheit längst bekannt:
Das Sparen erzeugt gerade erst Kreditbedarf bei verringertem Umsatz, umgekehrt wird, wenn Sparer frühere Ersparnisse aufzehren, die Liquidität der Banken wie der Unternehmungen gesteigert und zugleich das Unternehmereinkommen.
Wilhelm Lautenbach: Zins, Kredit und Produktion (PDF), 1952, S. 62
Loanable Fund Theory
Mit der Loanable Fund Theory wird den Studenten und dem Publikum eingeredet, dass die Güternachfrage nicht unbeschränkt durch zusätzliche Kreditvergabe gesteigert werden kann, sondern die Kreditvergabe auf das Volumen eines "Loanable Fund" beschränkt wäre. Kreditfinanzierte Staatsausgaben würden einen Teil der verfügbaren Kredite für den Staat verbrauchen und die kreditsuchenden Unternehmer verdrängen.
Meist ist die Darstellung des angeblichen Loanable Funds nicht direkt falsch, sondern es wird einfach versucht, die falschen Vorstellungen im Kopf der Studenten und des Publikums mit einer ausführlichen Erörterung der Herkunft der Bankeinlagen anzuregen. Dass also die Ersparnisse der Bürger und Firmen und der Haushaltsüberschuss des Staates und Kredite des Auslands den Loanable Fund mit dem zu verleihenden Geld auffüllen würden und so weiter und dass es einen Zinssatz geben würde, bei dem Ersparnisse und Kreditnachfrage im Gleichgewicht seien.
Das Publikum soll glauben, dass nur Erspartes verliehen werden kann. Dann würde ein Kredit keine zusätzliche Nachfrage schaffen, weil ja vorher jemand beim Sparen für den Kredit genau auf diese Nachfrage verzichtet hätte. Unlängst wurde dieser Schwindel von dem "Keynesianer" und "Wirtschaftsnobelpreisträger" Paul Krugman auf seinem NYTimes-Blog wieder dargeboten. Man sollte es nicht für möglich halten:
If I decide to cut back on my spending and stash the funds in a bank, which lends them out to someone else, this doesn’t have to represent a net increase in demand.
Hätte er sein Geld verjubelt, wäre es jetzt halt auf einem anderen Bankkonto, statt auf seinem. Dort könnte es von der Bank auch nicht nochmal verliehen werden. Das weiß der Princeton-Professor Paul Krugman sicher, darf es den Leuten aber nicht verraten, wenn er nicht die Finanzoligarchen verärgern will, die ihm den Nobelpreis verschafft haben. Da kann er die Ausweitung der Güternachfrage durch Kreditschöpfung einfach nicht verstehen:
I think it has something to do with the notion that creating money = creating demand, but again that isn’t right in any model I understand.
Man beachte die geschickte Formulierung (wie oben schon Ulrich Van Suntum): Kreditschöpfung belebt tatsächlich in keinem VWL-Modell die Nachfrage, das hat Paul Krugman völlig richtig verstanden und wir können ihm da wirklich nicht widersprechen: Auf dem Kapitalmarkt der VWL-Modelle wird reale Ersparnis von den Haushalten angeboten und von Investoren nachgefragt; Geld schöpfender Kredit ist auf dem VWL-Kapitalmarkt unbekannt, Geld höchstens Tauschmittel.
Die Loanable Fund Theory soll dem Publikum verbergen, dass das private Bankensystem einschließlich der FED die Geldschöpfung vollkommen kontrolliert, den Kredithahn aufdrehen und ganz nach Belieben zudrehen kann, um damit die für Börsenspekulanten und große Finanzkapitalisten so lukrativen Booms und Krisen zu inszenieren. Dafür hält man sich einen Paul Krugman, der als berühmter Kolumnist in der New York Times jeden Tag tolle Artikel gegen die Neoliberalen schreiben darf, aber ohne zum Kern der Dinge vorzudringen, bei dem er sich von Neoklassikern plötzlich nicht mehr unterscheidet.
Loanable Funds Theory of Interest
Wir kennen die Geschichte schon von den Klassikern, dass angeblich die Haushalte ihre Ersparnisse auf einen Kapitalmarkt bringen würden. Das Gleichgewicht am Kapitalmarkt sei dann der Zins, bei dem das Angebot an Ersparnissen der Nachfrage der Unternehmen nach Finanzierungen entspreche. Die Formel lautet für den Zins:
r = f(I,S) mit r = Zins, I = Investition, S = Ersparnis
Die Haushalte würden also an den Ausgaben für den Konsum sparen und dabei, so die mikroökonomische Vorstellung, steigt ja bei unveränderten Einkommen die Ersparnis, es bleibt als reale Ersparnis behandeltes Geld übrig, das zusätzlich am Kapitalmarkt angeboten zu sinkenden Zinsen und dadurch steigenden Investitionen führe. Gegen diese mikroökonomische Vorstellung muss immer wieder betont werden, dass sinkende Ausgaben makroökonomisch zu sinkenden Einkommen führen. Das Sparen am Konsum hat also zur Folge, dass die Einkommen im Umfang des Konsumverzichts sinken. Auch die Investitionen sinken, weil ja weniger produziert wird. Um bei sinkender Konsumnachfrage und Produktion die Investitionen zu beleben, müsste der reale Zins stark unter Null fallen, so dass Inflation eine Flucht in Sachwerte auslöst.
Es gibt makroökonomisch keine Ersparnisse, die von den Haushalten auf einen Kapitalmarkt gebracht und dort verliehen werden könnten. Die volkswirtschaftliche Ersparnis entsteht mit der Nettoinvestition und ist mit dieser identisch. Das Verleihen der Ersparnisse ist wie das Verleihen gesparten Geldes eine mikroökonomische Täuschung. Dem entsprechend gibt es auch keinen Zins für ein Gleichgewicht, da die Investition die Ersparnis schafft und nur durch das Produktionspotential beschränkt wird.
Im äußersten Fall einer Vollauslastung des Produktionspotentials müsste eine sinnvolle Geldpolitik die Zinsen erhöhen, um einen preistreibenden Boom zu dämpfen. Bei Unterauslastung gibt es überhaupt keinen Grund, warum die Zinsen bei einer größeren Nachfrage für Investitionsfinanzierungen steigen sollten. Bei sehr starker Unterauslastung müssten die Zinsen sogar mit steigender Nachfrage eher sinken, weil die Risiken dann für die Banken geringer werden. Ein Konsumverzicht der Haushalte wäre also nur an der Kapazitätsgrenze der Ökonomie für größere Investitionen sinnvoll und die Zinserhöhung der Notenbank sorgt dann einerseits für den Konsumverzicht der Haushalte wie für den Rückgang der Investitionen.
Beginnend mit Knut Wicksell wurde die klassische Vorstellung durch eine Loanable Funds Theory of Interest für die Neoklassik und den Bastardkeynesianismus erweitert:
r = f(I,S,M,H) mit M für das sogenannte Geldangebot und H für das Hoarding, also das Horten von Zentralbankgeld
In der neuen Formel wird die schon von den Klassikern erfundene Ersparnis also um die angeblich durch die Notenbank gesteuerte Geldmenge bereichert, während die Nachfrage nun nicht nur aus dem Kreditbedarf der Investoren besteht, sondern zusätzlich noch die Horter von Zentralbankgeld die Nachfrage erhöhen.
Angeblich habe sogar Keynes diese Zinstheorie wegen der Liquiditätsfalle(PDF) genauestens studiert. Jedenfalls verwechseln die Bastardkeynesianer ständig das Problem des Zins- und Kursrisikos für langlaufende Anleihen mit einer Erhöhung der Nachfrage nach ihrem angeblichen Geldangebot der Notenbank auf einem Geldmarkt (das bei fiat money nur willkürlich beschränkt wäre) oder nach erfundenen Loanable Funds durch die sogenannte Geldhortung wegen Liquiditätspräferenz.
Gold- und Silbermünzen und das erste Buchgeld mit den ersten Krisen
Am Anfang war das Münzgeld aus Gold und Silber und die Münzen hatten genau den Wert des in ihnen enthaltenen Edelmetalls. Das Bezahlen mit diesen Münzen war darum auch ein Problem, weil sie auf eine Goldwaage gelegt und geprüft werden mussten und nicht selten abgegriffen oder sonst im Wert gemindert waren. Das große Geschäft der ersten Bankiers war nicht der Geldverleih auf Zins, sondern der Münzwechsel mit entsprechenden Wertabschlägen und die Gutschrift von Buchgeld für Münzen aus aller Herren Länder. Mit diesem Buchgeld konnte ohne Abschlag und Wertverlust gezahlt werden und man konnte Geld sogar versenden, ohne Räuber fürchten zu müssen; es war also besser als Bargeld aus Edelmetall, solange die Bankiers ehrlich und solvent blieben.
Das Buchgeld der Bankiers konnte auch geliehen werden. Die Kredite hatten dieselbe Wirkung wie das neue Gold und Silber aus den eroberten Kolonien: Die Wirtschaft florierte durch zusätzliches Geld aus den vergebenen Krediten, die Löhne und sonstigen Einkommen stiegen mit der Beschäftigung, aber die Güter wurden immer teurer. Sogar wenn die Bankiers ganz rechtschaffen und ehrbar Kredite nur an kreditwürdige Kunden gegen entsprechende Sicherheiten und Pfänder vergaben, das von ihnen geschöpfte Buchgeld und die ausgestellten Geldzettel also gut besichert und keinesfalls wertlos oder gar betrügerisch waren, kam es für die Bankiers zu einem Problem: Die blühende Konjunktur, die sie mit ihrer Kreditvergabe ermöglicht hatten, führte zu steigenden Preisen und damit zu Defiziten in der Handelsbilanz mit dem Ausland. Ein Defizit im Außenhandel musste mit dem Export von Edelmetall beglichen werden, so dass die Bankiers ihre Kundeneinlagen an Edelmetall an das Ausland verloren.
Schnell entdeckten die Bankiers, dass sich mit jeder Einschränkung der Kredite die Ökonomie in eine Krise stürzen ließ, so dass die Preise wie die Löhne wieder sanken bis in der Handelsbilanz ein Überschuss verblieb und damit das Edelmetall wieder zu ihnen zurück floss. Mit jeder Krise waren sogar wertvolle Güter und Firmenanteile spottbillig zu haben und lästige Konkurrenten konnten in den Bankrott getrieben werden. Die Bankiers mussten also die Kredite immer wieder einschränken und verlegten sich daher auf kurzfristige Kredite wie den Wechseldiskont, weil sich jeder Kunde sein Geld von den Bankiers zu jeder Zeit in Gold auszahlen lassen konnte. Während bei zu vielen langlaufenden Krediten das Gold der Bankiers nicht mehr für alle Ansprüche ihrer Kunden gereicht hätte, konnte mit dem Wechseldiskont schnell auf einen drohenden Bankrun der Kunden reagiert werden. Sobald das Edelmetall von den Banken abfloss und eine Knappheit zu befürchten war, reduzierten die Bankiers ihre Kredite, erhöhten die Zinsen und stellten den Wechseldiskont ein, wodurch immer wieder Handelskrisen ausgelöst wurden. Ohne erneuerten Kredit von den Bankiers mussten die Kunden für anfallende Zahlungen ihr Edelmetall zu den Banken zur Gutschrift für den Zahlungsempfänger bringen, anstatt wie sonst üblich diskontierbare Wechsel auszustellen oder einen Kredit aufzunehmen, so dass die Goldreserven der Bankiers wieder rasch stiegen.
Das Geldding in seiner Menge und Umlaufgeschwindigkeit
Aus dieser Zeit der Gold- und Silbermünzen stammt die Vorstellung eines umlaufenden Gelddings oder gar einer ganzen Menge dieser umlaufenden Gelddinger und die Idee des Zusammenhangs zwischen der Höhe der Preise in einer Ökonomie und der Geldmenge, die da umlaufe. Die irgendwie definierte Geldmenge M würde dabei in einem bestimmten Zeitraum mehrmals durch Transaktionen von einer Hand in die nächste oder von einem Konto auf das andere wechseln, was als Umlaufgeschwindigkeit V bezeichnet wird. Bei fiat money wird die Vorstellung einer umlaufenden Geldmenge zwar erheblich schwieriger, weil der Saldo aller Geldmengen in einer Makroökonomie immer genau Null ist, wenn wir von den Guthaben die Schulden abziehen. Trotzdem hat sich in der VWL die Meinung halten können, dass es da ein umlaufendes Geld gäbe, dessen Menge bei einer angenommenen Konstanz der Umlaufgeschwindigkeit die Preise bestimme.
Ohne eine ausreichende Geldmenge würden die Haushalte in ihren Transaktionen behindert, weshalb die Haushalte versuchen, diese umlaufende Geldmenge in Übereinstimmung mit ihren Transaktionsplänen zu halten. Weil dies aus verschiedensten Gründen für VWL-Professoren anscheinend schwierig ist, verursachen die Haushalte in den Köpfen der Professoren bei dem Versuch der Anpassung ihrer Geldmenge an ihre Bedürfnisse die größten Preisschwankungen und beeinflussen sogar die Zinsen auf dem Anleihenmarkt.
Zum Beispiel könne es passieren, dass die Preise gestiegen wären und die umlaufende Geldmenge nun zu gering sei. Nun würden die Haushalte (sich gegenseitig?) ihre Anleihen verkaufen, um an die fehlende "Geldmenge" zu kommen. Dabei stiegen dann die Zinsen auf dem Anleihenmarkt, weil durch das größere Verkaufsangebot die Kurse fallen. Allerdings steigt dabei keine "Geldmenge", noch nicht einmal eine in den "Transaktionskassen", weil eine Anleihe nur verkauft werden kann, wenn es dafür auch einen Käufer gibt, der dafür genau die Geldmenge zahlt, die der Verkäufer erhält. Ökonomische Zusammenhänge sind schwierig, wenn Professoren immer nur vom mikroökonomischen Standpunkt aus denken können.
Zum Glück ist die Anpassung der "Geldmenge" an steigende oder sinkende Preise auf andere Weise schon erfolgt, nämlich automatisch über die mit steigenden oder fallenden Preisen verbundenen steigenden oder fallenden Umsätze und damit Einkommen. Diese Einkommen sind nämlich genau das, wofür die Professoren sich ihre "umlaufende Geldmenge" zusammen spinnen. Für diese steigenden oder fallenden Umsätze braucht das Bankensystem so wenig irgendeine "Geldmenge" wie es diese auch nicht für eine zusätzliche Kreditvergabe benötigt. Wir können uns eine Ökonomie denken, in der alle Zahlungen bargeldlos über Bankkonten abgewickelt werden und zum Ausgangszeitpunkt alle Konten auf Null stehen. Nach einem bestimmten Zeitraum sollen alle Haushalte ihr gesamtes Einkommen so ausgegeben haben, dass alle Konten zum Endzeitpunkt wieder auf Null stehen. Es lässt sich also weder zu Beginn noch zum Schluss irgendeine Geldmenge in der Ökonomie feststellen und dazwischen kann das Bankensystem durch Überweisungen mit vorübergehender Überziehung der Konten die Transaktionen mit jedem beliebig hohen Preisniveau abgewickelt haben. Die angeblich für die Höhe der Preise in der Quantitätsgleichung und der Quantitätstheorie verantwortliche "umlaufende Geldmenge" erweist sich damit als ein reines Hirngespinst der VWL-Professoren.
Falls sich von heute auf morgen sämtliche Preise und Löhne verdoppeln, buchen die Banken ab morgen für die Zahlungen der Käufe und Einkommen die doppelten Beträge von gestern; Einkommen und Ausgaben verdoppeln sich nominal - nur die Schulden hätten sich real um die Hälfte entwertet. Ach ja, das Bargeld in den Geldbörsen und Ladenkassen muss sich jetzt auch verdoppeln. Bei den Ladenkassen geht das mit den Verkäufen ab morgen von selber, aber die Haushalte werden jetzt halt statt 100 Geld 200 Geld von ihrem Konto aus dem verdoppelten Einkommen abheben. Das Bankensystem leiht sich also ab morgen von der Zentralbank die doppelte Menge Bargeld und zahlt es den Kunden aus.
Bei ab morgen halbierten Preisen und Löhnen halbieren sich ab morgen die Zahlungen für Käufe und Einkommen, die Banken schicken die Hälfte des Zentralbankgeldes zur Gutschrift an die Notenbank und dort kommt es in die Papierpresse. Sonst noch ein Problem mit "Geldmenge" und "Transaktionskassen"?
Wie Geldmengen auf einem Geldmarkt die Preise steuern sollen
Der ganze Geldmengenstuss soll die Studenten und das Publikum glauben machen, dass die Notenbanken keinen Einfluss auf die Konjunktur hätten, weder Krisen verursachen noch beenden könnten, sondern nur eine "Geldmenge" steuern, mit der sich entweder generell oder auf längere Sicht allein die Preise beeinflussen ließen. Dass durch restriktive Kreditvergabe Krisen und Deflation ausgelöst werden, während eine expansive Geldpolitik die Konjunktur belebt und dabei die Preise steigen, muss die VWL leugnen und bestreiten.
Die Formel für den angeblichen Zusammenhang von Geldmenge und Preisniveau lautet nach der Quantitätsgleichung von Irving Fisher:
Geldmenge x Umlaufgeschwindigkeit = Preisniveau x reales BIP
M x V = P x Y
Die sogenannte Umlaufgeschwindigkeit ist weder zu messen noch nach anderen Verfahren zu bestimmen, außer dass man sie gerade passend zu der „Geldmenge“ in der oben angegebenen Formel aus dieser berechnet. Wie die „Geldmenge“ für den Zahlungsverkehr korrekt definiert wird, ist umstritten und lässt sich so wenig an der Realität überprüfen wie deren „Umlaufgeschwindigkeit“; nur dass eben das V immer passend zu M berechnet werden muss. Die Quantitätsgleichung ist daher empirisch nicht zu überprüfen, mit den passend ausgerechneten Größen immer „richtig“ und grundsätzlich nicht falsifizierbar.
Der sogenannte Geldmarkt wird wie üblich als Diagramm dargestellt. Die Geldnachfrage steigt mit Y und mit dem Preisniveau, also mit dem Produkt PxY, während das Geldangebot einfach durch die Notenbank bestimmt ist. Weil das Geld auf die reale Größe Y keinen Einfluss haben soll, kann das Diagramm auf eine waagrechte Geldmengenachse und eine senkrechte Preisachse beschränkt werden. Dort schneidet dann eine von links unten (niedrige Geldmenge und Preise) nach rechts oben (hohe Geldmenge und Preise) steigende Nachfragegerade die irgendwo senkrecht auf der Geldmengenachse stehende Angebotsgerade. Das alles natürlich nur auf dem Papier oder an der Wand. Eine Geldhortung ist von Klassikern und Neoklassikern unter keinen Umständen vorgesehen, daher steigen die Preise genau mit der Menge des Geldes, jedenfalls in der Theorie.
Mit der Annahme, dass die Umlaufgeschwindigkeit unverändert bliebe, behaupten die VWL-Professoren einen kausalen Zusammenhang zwischen „Geldmengen“ und Preisniveau, dass nämlich Inflation die Folge einer von der Notenbank fahrlässig zu sehr vermehrten Geldmenge wäre und ganz einfach mit einer richtigen „Geldmengensteuerung“ zu verhindern wäre. Das ist selbstverständlich alles reinster Stuss.
Darauf werden wir unten im Zusammenhang mit dem Monetarismus näher eingehen. Hier ist nur noch wichtig, dass der „Geldmarkt“ in vielen Darstellungen des neoklassischen Gesamtmodells über den Arbeitsmarkt an die übrigen Märkte angebunden wird, um eine höhere Komplexität dieses Gesamtmodells vorzugaukeln. Auf dem Arbeitsmarkt ist dabei der Nominallohn angegeben, der dann erst mit dem auf dem Geldmarkt von der Geldmenge bestimmten Preisniveau zum Reallohn wird. Eigentlich ist aber nach den neoklassischen Vorstellungen der Reallohn die auf dem Arbeitsmarkt verhandelte Größe und ein Nominallohn kommt dabei in der Modellvorstellung nicht vor.
Der Geldmarkt steht nach den Annahmen der Neoklassiker nicht in kausaler Verbindung zum Gütermarkt oder Arbeitsmarkt (auch nicht zum Kapitalmarkt), womit das Gesamtmodell sehr unterkomplex wird.
Transaktionskassen und Preise
Die absurde Geschichte geht so: Eine Erhöhung der Geldmenge führe zu einem Überschuss in der Transaktionskasse im Verhältnis zu den real geplanten Ausgaben und zu einer steigenden Nachfrage mit steigenden Preisen. Die Haushalte zahlen den Überschuss aus ihrer Transaktionskasse nicht bei den Banken ein, die das Geld dann an die Zentralbank zurückreichen, wo es in der Papierpresse landet. Nein - die Haushalte geben so lange mehr Geld aus, bis die Preise gestiegen sind und der Überschuss in der Transaktionskasse zu den real geplanten Ausgaben mit der Inflation verschwunden ist.
Das Rätsel, wie die Eigentümer der Transaktionskassen dort plötzlich zuviel Geld vorfanden, so dass sie für höhere Preise sorgen mussten, damit das Verhältnis Geldmenge zu Preisen wieder stimmt, blieb ungelöst. Nur Milton Friedman hat mit seiner Geschichte vom Hubschrauber, der über einer Ökonomie Geld abwirft, einmal anschaulich zu machen versucht, wie es zu einem ungewollten Überbestand an Geld in den Transaktionskassen kommen könnte: Das vom Hubschrauber abgeworfene Geld hat natürlich jeder aufgesammelt, wo es doch umsonst herumlag, und damit seinen Kassenbestand verdoppelt; dann konnten die Leute damit nur noch kaufen, kaufen, kaufen, bis die Preise sich verdoppelt hatten. QED: Die Geldmenge bestimmt das Preisniveau. Falls die Notenbank mit einer Senkung der Zinsen die Haushalte veranlasst, eine größere Transaktionskasse zu halten, ist der Anstieg der Geldmenge zur Transaktion so gewollt, die Haushalte halten also nicht zu viel Geld, und das dürfte keine Preisänderungen verursachen. Wie man die Geschichte auch dreht und wendet - sie ergibt keinen Sinn!
Bei einem Rückgang der Geldmenge in der Transaktionskasse sinken angeblich die Ausgaben und Preise bis die Geldmenge wieder zu den realen Transaktionen passt. Knut Wicksel hat sich das so vorgestellt:
Ich suche deshalb meine Kasse zu verstärken, was ... nur durch verminderte Nachfrage nach Waren und Leistungen oder durch vermehrtes ... Angebot meiner eigenen Ware oder durch beides zugleich erzielt werden kann. Dasselbe gilt von allen anderen Warenbesitzern oder –konsumenten.
Knut Wicksell, Geldzins und Güterpreis, Jena 1898, S. 61
Wenn jeder mehr Waren anbietet und weniger nachfragt, sinken die Preise und die Kassenhaltung steigt real.
Wie es zu einem offenbar ungewollten Rückgang der Kassenbestände gekommen sein soll, bleibt ungeklärt. Bei den Monetaristen steuert ja die Notenbank die Geldmenge und hat wohl durch einen uns unbekannten Mechanismus (Hubschrauber?) das Geld in den Transaktionskassen gegen den Willen der Eigentümer abgesaugt. Wir könnten auch annehmen, dass die Notenbank durch eine Zinssenkung den Wunsch nach einer größeren Transaktionskasse bewirkt hat, so dass also die vorhandenen Kassenbestände als zu gering empfunden werden. Dann müsste allerdings der von Wicksell zitierte Anpassungsprozess eines verstärkten Angebots und verringerter Nachfrage als Reaktion auf eine Zinssenkung der Zentralbank genau das Gegenteil der zu erwartenden und historisch bekannten Folgen von Zinssenkungen sein, dass nämlich mehr gekauft und weniger angeboten wird. Ich muss mich wiederholen: Wie man die Geschichte auch dreht und wendet - sie ergibt keinen Sinn!
Im VWL-Modell werden selbst am angeblichen Kapitalmarkt nur Beteiligungen gehandelt, so dass Kassenbestände dort weder angelegt noch ergänzt werden könnten. Es ist also im absurden Modell der VWL tatsächlich so, dass eine ungewollte Änderung der Kassenbestände in der Ökonomie nur durch eine Inflation oder Deflation der gesamten Preise der Ökonomie korrigiert werden könnte. Und zu genau diesem Zweck wird dann kurzfristig das Postulat der Neutralität des Geldes ausgesetzt, damit die Änderung der Geldmenge sich über die Änderung der Nachfrage auf die Preise auswirken kann.
Diese merkwürdige Geschichte findet sich vor allem bei den Monetaristen, weil doch die umlaufende Geldmenge einen Einfluss auf die Preise haben soll. Dabei wurde glatt übersehen, dass es in einer realen Ökonomie im Unterschied zu den VWL-Modellen außer dem Bargeld in den Kassen noch so etwas wie Geldvermögen und Schulden gibt. Die Beziehung zwischen den Kassenbeständen und den Geldvermögen oder Schulden ist sehr eng, weil die Kassenbestände jederzeit durch Ein- und Auszahlungen an den realen Bedarf angepasst werden können und nicht durch vermehrte oder verminderte Käufe.
In der Realität gehen die Leute also zur Bank und zahlen den Überschuss aus ihrer Transaktionskasse im Verhältnis zu den geplanten Ausgaben dort ein oder sie lassen sich das in der Transaktionskasse für die geplanten Ausgaben fehlende Geld von ihrem Konto auszahlen. Nur gibt es dann keine Erklärung für den angeblichen Zusammenhang zwischen einer steigenden oder fallenden Geldmenge und steigenden oder fallenden Preisen.
Der Saldo zwischen Geldvermögen und Schulden ist Null, die Menge der Geldvermögen und Schulden kann also die Güternachfrage nicht beeinflussen. Anders ist es mit der Höhe der Zinsen. Eine Erhöhung der Zinsen führt zu verstärktem Sparen, also zu weniger Nachfrage sowohl der Schuldner, die ihre Schulden verringern möchten, wie der Eigentümer der Geldvermögen, die ihre Geldvermögen vermehren wollen. Der Saldo bleibt Null, aber die Güternachfrage bricht ein und damit kommt es zu sinkenden Preisen. Umgekehrt lässt eine Senkung der Zinsen die Gläubiger weniger sparen und die Schuldner leichter neue Schulden aufnehmen. Die Nachfrage nach Gütern steigt und damit auch die Preise.
Das Fallen und Steigen der Preise lässt sich also mit der Zinspolitik leicht und verständlich erklären, während ein Erklärungsversuch mit der Geldmenge nicht überzeugt.
Wie eine Deflation angeblich die Konjunktur ankurbelt
Der Realkassen-Effekt
Mit dem Realkassen-Effekt räumt die VWL zwar erstmals einen monetären Einfluss auf Güternachfrage und Konjunktur ein, aber sie stellt die Zusammenhänge gleich vollständig auf den Kopf. Statt eine Belebung der Güternachfrage durch Inflation und eine krisenverschärfende Wirkung der Deflation zu diskutieren, behauptet die VWL, Deflation würde die Konjunktur beleben und gar durch einen Vermögenseffekt sinkender Preise bei der Überwindung von Krisen helfen. Paul Krugman können wir hier zustimmend zitieren, der sich zu diesen Real balance effects (wonkish) auf seinem Blog so geäußert hat:
Before the world went crazy, the US monetary base was about $800 billion. Suppose that the price level fell 20 percent. This would raise the real value of that base by $160 billion. Right there you can see the problem — the housing bust has wiped out something like $6 trillion of wealth; compare that with the effects of even a drastic fall in the aggregate price level.
Es gibt verschiedene Konzepte für den angeblich positiven Vermögenseffekt der Deflation:
Einmal soll er nur im steigenden Wert der Goldreserven bestehen; dann auch im steigenden Wert der von der Zentralbank emittierten Münzen und Noten (Realkassen-Effekt), weil die Zentralbank im Gegensatz zu einem Schuldner kein Problem mit diesem durch Deflation steigenden Geldwert habe.
Nach Pigou soll besonders der steigende reale Wert der Staatsanleihen deren private Halter vermögender und damit weniger sparsam werden lassen (Pigou-Effekt).
Der Gipfel der Verwirrung der Studenten wird damit erreicht, dass die VWL sich erdreistet, einen aus der angeblich konjunkturfördernden Wirkung der Deflation abgeleiteten Effekt ausgerechnet nach John Maynard Keynes zu benennen, der die Deflation stets für krisenverschärfend und konjunkturschädigend hielt und sich zu seiner Zeit für eine Reflation der Preise ausgesprochen hatte.
Eine Kombination und Mischung aus alledem haben wir zuletzt mit dem Patinkin-Effekt (Realkassenhaltungs-Effekt).
Jedenfalls soll die Konjunktur in allen Fällen durch Deflation gefördert werden, was im neuesten Werk von Gregory Mankiw (Grundzüger der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 2012, S. 904ff) immer noch gelehrt wird. Man könnte aber mal in die Geschichtsbücher schauen, da hatte die Deflation nämlich immer verheerende Auswirkungen und es kam erst durch Reflation wieder zu einer besseren Konjunktur.
Der Pigou-Effekt
Der Pigou-Effekt behauptet einen Anstieg der Güternachfrage durch fallende Preise. Die fallenden Preise würden die Kaufkraft der umlaufenden Geldmenge erhöhen und den realen Wert der Staatsanleihen von privaten Haushalten erhöhen, so dass mit diesem Vermögenseffekt die Sparneigung sinke und die Güternachfrage steige. Dass die Weltwirtschaftskrise gerade das genaue Gegenteil bewiesen hatte, war vermutlich für die Anhänger dieses Schwindels ein besonderer Reiz.
Arthur Cecil Pigou, der Erzrivale von John Maynard Keynes in allen Fragen der Konjunktur- und Beschäftigungstheorie, untersuchte seit dem Ende der 20er Jahre und vor allem in seinem Werk The Theory of Unemployment (1933) die Elastizität der Arbeitsnachfrage und war für Lohnsenkungen zur Erhöhung der Beschäftigung eingetreten. Dabei führte Pigou die Arbeitslosigkeit wesentlich auf die Starrheit der Löhne zurück, die durch die Sozialgesetzgebung und die Erwerbslosenunterstützung bestärkt würde. Nachdem Keynes in seiner Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes den Nutzen von Lohnsenkungen bestritten hatte, verlagerte Pigou sein Interesse auf ein Modell, das die Geldlöhne über die Zinsen mit der Beschäftigung derart verbinden sollte, dass wieder sinkende Löhne zu steigender Beschäftigung führen müssten. Unter dem Einfluss von Nicholas Kaldor stützte sich Pigou bereits in seinem Werk Employment and Equilibrium (1941) auf das von John Hicks entwickelte IS-LM-Modell, mit dem die Thesen von Keynes zu einer Neoklassischen Synthese verkürzt wurden. In diesem Werk und in seinem Artikel The Classical Stationary State (1943) entwickelte er die später als Pigou-Effekt bezeichnete These einer die Konjunktur und Beschäftigung fördernden Wirkung der Deflation.
Der angebliche Keynes-Effekt
Beim sogenannten Keynes-Effekt löse eine Preissenkung eine reale Steigerung der Geldmenge aus, mit der die Haushalte Wertpapiere nachfragen. Das führe zu einem Nachfrageüberschuss auf dem Wertpapiermarkt und damit zu sinkenden Zinsen. Es gehe damit weiter, dass wegen der gesunkenen Zinsen die Investitionen steigen würden und mit den Investitionen die Güternachfrage, die Produktion und das gesamtwirtschaftliche Einkommen, also Y. So führe die Deflation (ganz im Widerspruch zu Keynes) zu steigender Güternachfrage und Beschäftigung.
Man hat sich mit diesem Schwindel auf Keynes berufen, wohl weil er in seiner Allgmeinen Theorie im 19. Kapitel (Berlin 2006/1936 S.222) die verschiedenen Auswirkungen von Änderungen der nominalen Löhne und Preise im Zusammenhang mit der Kassenhaltung und der Liquiditätspräferenz und den Zinsen behandelt hat. Von einer Kürzung der Geldlöhne bei sinkenden Preisen und Geldeinkommen sei ein sinkendes Bedürfnis nach Kassenhaltung für Geschäftszwecke zu erwarten; die Liquiditätspräferenz in der Ökonomie sinke mit der Deflation, dies werde den Zinssatz senken und für die Investition günstig sein. Keynes hatte jedoch im vorangehenden Absatz betont, dass die Erwartung weiter sinkender Löhne und Preise zum Aufschub von Investition und Konsum führt und eine positive Wirkung auf die Konjunktur nur durch die Erwartung jetzt wieder steigender Löhne und Preise (Reflation) möglich wäre. Genau diese Erwartung wieder steigender Preise würde dem Fall der langfristigen Zinsen entgegen wirken. Ganz offensichtlich wollte Keynes auch in diesem Absatz seines Werkes nicht für die Deflation eintreten.
Der Realkassenhaltungs-Effekt von Don Patinkin
Die Geldmenge in der Transaktionskasse soll nach diesem Realkassenhaltungs-Effekt nicht nur das Preisniveau steuern, also Inflation und Deflation auslösen, sondern ganz nach Bedarf auch die Konjunktur aus einer deflationionären Depression retten. So wollte es jedenfalls der dafür gerühmte Don Patinkin in seinem Werk „Money, Interest und Prices“ (1956).
Eine Deflation der Preise erhöhe die Kaufkraft der umlaufenden Geldmenge und steigere, ganz anders als von Keynes behauptet, die Güternachfrage und sorge für mehr Beschäftigung. Die Gegenposition als Schuldner der umlaufenden Geldmenge hält die Zentralbank, so dass sich aus dem mit der Deflation steigenden Gewicht der Schulden kein negativer Effekt für die Güternachfrage und die Konjunktur ergebe. Je mehr die Preise in einer deflationären Depression sinken, desto eher werde Vollbeschäftigung erreicht.
Dass der negative Effekt einerseits von den in jeder Ökonomie unter einer Deflation leidenden Schuldnern und zusätzlich den von der Deflation profitierenden Sparern, die um so mehr sparen möchten, je höher der Realzins durch den Preisverfall steigt, kommen könnte, haben Don Patinkin und die seine Erkenntnisse feiernden Ökonomen einfach nicht gesehen. Es gibt ja in den Modellen keine Schuldner und keine Rentiers, anders als in der Realität: Die Sparer werden also die steigende Kaufkraft ihrer Bargeldbestände zusätzlich als Geldvermögen sparen und für die Schuldner wird die Last der Schulden durch die gestiegene Kaufkraft ihres Bargelds kaum gemindert werden. Wie so oft ist auch beim Thema Realkasseneffekt an Verstand und Redlichkeit der Ökonomen zu zweifeln.
Im gleichen Werk hatte Patinkin selbstverständlich auch behauptet, dass eine größere Geldmenge (Hubschrauberabwurf?) die Preise steigen lasse, statt die Konjunktur zu beleben:
... an increase in the quantity of money disturbs the optimum relation between the level of money balances and the individual`s expenditures; this disturbance generates an increase in the planned volume of these expenditures (the real-balance effect); and this increase creates pressures on the price level which push it upwards until it has risen in the same proportion as the quantity of money.
Don Patinkin, Money, Interest, and Prices, S. 163 f.
Der Realkasseneffekt verstößt ja gegen die angebliche Neutralität des Geldes.
Das AS-AD-Modell
Im AS-AD-Modell haben wir auch ganz unscheinbar die deflationäre Ideologie in Gestalt einer von links oben (hohe Preise, niedriges Y) nach rechts unten (niedrige Preise, hohes Y) fallenden Nachfragekurve. Mankiw (a.a.O. S. 905, Schaubild) nennt für das Phänomen drei Gründe, das steigende Realvermögen bei fallenden Preisen, sinkende Zinsen und eine Abwertung der Währung. Das steigende Realvermögen betrifft wieder nur die umlaufende Geldmenge, die steigende Kaufkraft der Anleihen belohnt die Sparer und wird das Sparen verstärken, bei fallenden Preisen sinkt vielleicht der Nominalzins, aber es steigen der Realzins und die Last der Verschuldung. Die Abwertung der Währung soll die Folge der sinkenden nominalen Zinsen sein, wie der Mundell-Fleming-Wechselkurseffekt postuliert. Dabei wird wieder unterstellt, dass die Zentralbank keine Zinspolitik betreibe und der Zins vom Markt abhinge. In der Realität wird ein Sinken des Preisniveaus durch eine Hochzinspolitik der Zentralbank durchgesetzt werden. Sinkende Preise in einem Land führen in aller Regel zu einem steigenden Wechselkurs, steigende Preise zu einem sinkenden Wechselkurs, also dem genauen Gegenteil der These von Mankiw und Mundell-Fleming. Wir ersparen uns den Theoriestreit mit einem Blick in die Geschichtsbücher: Währungen stärker inflationierender Länder wurden abgewertet, deflationierende oder weniger inflationierende Währungen aufgewertet.
Allerdings muss im AS-AD-Modell die Nachfragekurve mit den Preisen fallen, weil doch die Angebotskurve mit den Preisen steigen soll, womit wir bei der ungeklärten Frage wären, ob steigende Preise nicht eher zu einer Zurückhaltung der Verkäufer führen, während die Käufer sich mit dem Kauf beeilen, um nicht noch mehr bezahlen zu müssen. Mit solchen Überlegungen wäre aber schon das gesamte AS-AD-Modell der VWL gegenstandslos. Tiefer wollen wir da gar nicht einsteigen, obwohl die VWL mit ihrem AS-AD-Modell sogar wieder die Neutralität des Geldes bewiesen haben will: Bei expansiver Geldpolitik würden sich nämlich einfach die beiden Kurven nach oben verschieben, so dass die anfangs belebte Produktion wieder in ihr "natürliches Niveau" bei gestiegenen Preisen zurückfalle. Dabei müssen die Studenten die Kurvenverschiebungen mit komplizierten Formeln berechnen, statt die Annahmen des Modells zu hinterfragen.
Zusammenfassung der Phänomene beim VWL-Geldmarkt
Streng nach dem VWL-Modell ist der einzige Anbieter von Geld auf dem VWL-Geldmarkt die Zentralbank. Geschäftsbanken mit kreditgeschöpftem Buchgeld sind nicht vorgesehen, denn die VWL-Professoren haben ihre Dogmen allein an einer umlaufenden Geldmenge von Münzen und Scheinen aufgehängt. Dass wir dieses Bargeld überhaupt nicht bräuchten und alle Zahlungen von Konto zu Konto ganz ohne Zentralbankgeld abwickeln könnten, ist schon das endgültige Urteil über den ganzen Unsinn, den die VWL-Professoren aus ihrem Geldmarkt herleiten wollen. Bargeld hat einen großen praktischen Nutzen, wenn wir unser Privatleben und Kaufverhalten nicht im Bankcomputer speichern wollen, aber für ökonomische Zusammenhänge ist Bargeldumlauf völlig verzichtbar. Wir bräuchten Zentralbankgeld schlicht überhaupt nicht und damit sind Quantitätsgleichung und Quantitätstheorie mitsamt LM-Kurve so gegenstandslos wie das Dogma einer Geldmengensteuerung der Preise.
Dass auf dem VWL-Geldmarkt nur die Zentralbank mit ihren Münzen und Scheinen das Geldangebot bestimmt, ist der Grund, warum das Problem der Transaktionskasse mit entweder zu viel oder zu wenig Geld diskutiert werden kann. Gäbe es Banken und Buchgeld im VWL-Modell, ließe sich die Transaktionskasse an der nächsten Bankfiliale dem Bedarf anpassen, ohne Auswirkung auf Preise oder Wertpapierkurse. Aber für die nachfolgenden Überlegungen müssen Sie sich noch einmal die absurden Annahmen des Modells zu eigen machen, wobei in der Quantitätsgleichung verschiedene Geldmengen, also auch mit Buchgeld wie M1, M2 und M3, gemeint sein können und die Umlaufgeschwindigkeit jeweils entsprechend berechnet wird.
Die Notwendigkeit für den VWL-Geldmarkt ergibt sich deswegen, weil steigende oder fallende Preise erklärt werden müssen. Für jeden denkenden Menschen erklären sich steigende oder fallende Preise durch eine sehr gut oder sehr schlecht laufende Konjunktur, also durch Boom oder Krise. Genau diese Erklärung darf die VWL aber nicht geben, weil zwischen der Realwirtschaft und dem Geld ja kein Zusammenhang existieren soll: Dichotomie und Neutralität des Geldes! Die VWL muss den Studenten wie dem Publikum dafür eine absurde Geschichte auftischen, in der angeblich eine Geldmenge die Preise bestimmt, wobei die Professoren sich nicht gern auf die maßgebliche Geldmenge festlegen lassen; es kann also M0, M1, M2 oder M3 gemeint sein. Wir sehen ja gerade, welchen Einfluss das QE der Zentralbanken auf die Preise hat.
Der Quantitätsgleichung liegt die Annahme zugrunde, dass alle Transaktionen mittels einer bestimmbaren Geldmenge (in Gestalt von Banknoten und Münzen oder Buchgeld) abgewickelt werden. Die irgendwie definierte Geldmenge M würde dabei in einem bestimmten Zeitraum mehrmals durch Transaktionen von einer Hand in die nächste oder von einem Konto auf das andere wechseln, was als Umlaufgeschwindigkeit V bezeichnet wird. Diese umlaufende Geldmenge ist nicht eindeutig zu definieren und ihre Umlaufgeschwindigkeit kann nicht gemessen werden. Daher wird die Umlaufgeschwindigkeit in der Quantitätsgleichung passend zur gewählten Geldquantität berechnet, so dass M*V=P*T gilt. Die Quantitätsgleichung ist definitionsgemäß immer wahr und empirisch nicht falsifizierbar.
Mit der Quantitätsgleichung ist die Vorstellung verbunden, dass die von der Zentralbank steuerbare Geldmenge (bei einer meist als konstant angenommenen Umlaufgeschwindigkeit) direkt das Preisniveau bestimmen würde, also ohne Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Damit ist die Quantitätsgleichung die Grundlage der Geldmengensteuerung und Stabilitätspolitik des Monetarismus. Milton Friedman erklärte Inflation oder Deflation zu einem rein monetären Problem, dem die Zentralbank durch die Steuerung der Geldmenge begegnen könne. Der verborgene Sinn des Monetarismus bestand selbstverständlich darin, dass die Geldpolitik wieder brutale Krisen inszenieren und dem Publikum erklären kann, man würde doch nur die Geldmenge steuern, um die Inflation zu bekämpfen.
Die Schlussfolgerungen aus der Quantitätsgleichung hängen nur davon ab, ob die Gleichung von links nach rechts gelesen wird, dass also eine höhere Geldmenge höhere Preise bewirke, oder einfach umgekehrt von rechts nach links, dass bei höheren Preisen ein größerer Geldumlauf erfolgt (siehe Joan Robinson, Ökonomische Theorie als Ideologie, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt 1980, S. 83). Die Gleichung beweist nicht, dass die höheren Preise von einer höheren Geldmenge verursacht wurden und nicht umgekehrt.
Der entscheidende Einwand betrifft die angeblich für das Preisniveau ursächliche Geldmenge, wie oben bereits erwähnt: Wir können uns eine Ökonomie denken, in der alle Zahlungen bargeldlos über Bankkonten abgewickelt werden und zum Ausgangszeitpunkt alle Konten auf Null stehen. Nach einem bestimmten Zeitraum sollen alle Haushalte ihr gesamtes Einkommen so ausgegeben haben, dass alle Konten zum Endzeitpunkt wieder auf Null stehen. Es lässt sich also weder zu Beginn noch zum Schluss irgendeine Geldmenge in der Ökonomie feststellen und dazwischen kann das Bankensystem durch Überweisungen mit vorübergehender Überziehung der Konten die Transaktionen mit jedem beliebig hohen Preisniveau abgewickelt haben. Offensichtlich handelt es sich bei der für die Preise angeblich verantwortlichen Geldmenge um ein Hirngespinst der VWL-Professoren.
Für den angeblichen Preiseffekt der Geldmenge muss die VWL vorübergehend die angebliche Neutralität des Geldes verletzen, ebenso für den Realkasseneffekt: Eine größere oder kleinere Geldmenge muss also zu mehr oder weniger Güternachfrage führen und damit die Güterpreise steigen oder fallen lassen oder auch die Konjunktur aus einer deflationären Depression retten. Das alles natürlich ganz so, wie es den VWL-Professoren gerade passt und für ihre Behauptungen benötigt wird.
Gelegentlich soll eine zu große oder zu kleine Transaktionskasse sogar Einfluss auf die Zinsen am Kapitalmarkt nehmen: Bei einer zu großen Transaktionskasse stiege die Nachfrage nach Wertpapieren zur Anlage für die überschüssige Geldmenge und führe zu sinkenden Zinsen am Kapitalmarkt, umgekehrt würden die Haushalte versuchen, Wertpapiere zu verkaufen, um ihre Transaktionskasse zu vergrößern, und damit die Zinsen am Kapitalmarkt erhöhen. Das Vermögen der Haushalte besteht nach Abzug des Konsums vom Einkommen (S=Y-C) aus Ersparnissen in Form von Geldmenge und Wertpapieren. Die Geldmenge wird nur von der Zentralbank bestimmt, denn Geschäftsbanken kommen in diesem Modell nicht vor. Mit Geschäftsbanken könnten sich die Haushalte nämlich sofort durch die Beleihung ihrer Sicherheiten Giralgeld ganz nach ihrem aktuellen Geld-Bedarf schaffen oder wieder verschwinden lassen, womit die ganze schöne Quantitätstheorie des Geldes mit allen Schlussfolgerungen erledigt wäre.
Warum eine Makroökonomie mit Geld kein Gleichgewicht findet
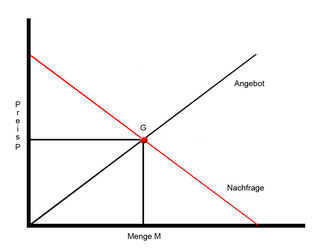
In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie das Ökonomen-X oder Marshall-Kreuz, mit dem für alle Märkte das berüchtigte Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage im Punkt G dargestellt wird. Wir haben also ein mit dem Preis steigendes Angebot und eine mit steigenden Preisen fallende Nachfrage. In einfachen Fällen kann es sich statt um zwei Kurven auch um zwei Geraden handeln, wie in der gewählten Abbildung, das ändert am Prinzip des Sachverhalts nichts.
Im Punkt G ist der Markt im sogenannten Gleichgewicht, weil jeder Anbieter, der mindestens den Preis G erhalten wollte, einen Käufer gefunden hat, der höchstens den Preis G bezahlen wollte; der Markt ist geräumt und es bleiben rechts von G die Anbieter, denen der Preis zu niedrig war, und die Nachfrager, denen der Preis zu hoch war.
Es ist die mikroökonomische Betrachtung: Käufer und Verkäufer gehen anschließend mit der Ware und dem Geld heim.
Besser kann es also zur allgemeinen Zufriedenheit nicht laufen, als dass Käufer und Verkäufer einen Preis finden, zu dem jeder der will kaufen und verkaufen kann; der Markt ist geräumt. Weil das so schön ist, suchen die VWL-Professoren auch bei ihren makroökonomischen Untersuchungen nach dem allgemeinen Gleichgewicht, das es in einer Makroökonomie mit Geld und Kredit aber grundsätzlich nicht geben kann.
Bei einer makroökonomischen Betrachtung wären die Käufer gleichzeitig Verkäufer anderer Güter und würden mit den Einnahmen aus ihren Verkäufen zahlen. Es gäbe kein Gleichgewicht bei einem bestimmmten Preis, denn höhere Preise würden zu höheren Einnahmen führen, mit denen die Käufer diese höheren Preise zahlen könnten. In Erwartung steigender Preise würden die Käufer auf Kredit immer noch mehr kaufen wollen und so die Preise weiter treiben. Bei einer Deflation dagegen führen sinkende Preise zu sinkenden Einnahmen und dem Versuch, mehr zu verkaufen und selber mit Käufen zu warten, was den Fall der Preise verstärkt. Es kommt in einer Makroökonomie mit Geld zu keinem Gleichgewicht, sondern entweder steigen die Preise und Umsätze oder sie fallen immer schneller. Nur die Geldpolitik kann gegen die Marktkräfte eine optimale Auslastung der Ökonomie anstreben, was im VWL-Modellbau aber kein Thema werden darf und abgestritten wird.
Bei makroökonomischer Betrachtung ist das Ökonomen-X also falsch und wir erhalten kein Marktgleichgewicht!
Sich verschärfendes Ungleichgewicht trotz „Angebot = Nachfrage“
Ohne Geldvermögen und Schulden wäre der Gütermarkt immer und überall im Gleichgewicht. Denn das Einkommen ist gleich der Nettoproduktion und die Summe der Ausgaben ist in der Makroökonomie gleich der Summe aller Einnahmen, so dass die Ausgaben genau der Nettoproduktion entsprechen.
Falls ein Unternehmen in einem Zeitraum mehr produziert hat, als es verkaufen konnte, ist es zu einer ungeplanten Lagerinvestition gekommen; diese kann das Unternehmen mit einer Einschränkung der Produktion sofort ausgleichen, andernfalls ist das Unternehmen selbst der Käufer seiner nicht abgesetzten Güter. Können überschüssige Güter überhaupt nicht mehr abgesetzt werden, zählen sie nicht zur Nettoproduktion, sondern zu den üblichen Reibungsverlusten. Im Prinzip müssen Unternehmen immer zusehen, dass sie nur das produzieren, was sich verkaufen lässt, in einem Boom wie in einer Krise. Eine Absatzkrise führt also nicht zu steigenden Lägern, sondern zu sinkender Produktion.
Für jede Höhe der Einkommen ist die Nachfrage gleich dem Angebot, aber das Theorem von Say, wonach es keine Absatzkrisen geben könne, ist falsch. Auch die Behauptung, dass der Gütermarkt von selbst zu einem Gleichgewicht strebe, ist falsch.
Das im VWL-Modellbau gezielt übersehene Geld sorgt für ein sich immer selbst verstärkendes Ungleichgewicht. Eine Inflation verstärkt die Güternachfrage und damit wieder die Inflation, weil das Halten von Geld bei steigenden Preisen einen realen Verlust bedeutet. Bei einer Deflation werden Käufe eingeschränkt, um lieber das in seiner Kaufkraft steigende Geld zu halten, wodurch die Preise immer mehr sinken müssen. Nur die Geldpolitik kann mit niedrigen oder hohen Zinsen und mit Defiziten oder Überschüssen des Staates gezielt gegen die Marktkräfte ein Gleichgewicht herstellen und Produktion und Auslastung der Ökonomie in einem optimalen Bereich halten.
Besonders die immer wieder von den VWL-Professoren geforderte Senkung der Löhne bei Krise und Arbeitslosigkeit würde eine eingetretene Absatzkrise mit sinkenden Preisen und weiter sinkender Nachfrage prozyklisch verschärfen.
In Modellen mit einem Modellgeld, das lediglich als Tauschmittel dient und nicht zu Geldvermögensbildung und Verschuldung, kann die ökonomische Realität grundsätzlich nur falsch dargestellt sein. Denn die Schulden und die Geldvermögen sind der Grund für eine im inflationären Boom immer weiter steigende oder in der deflationären Depression immer mehr sinkende Nachfrage und damit für das sich durch die ungehinderten Marktkräfte verstärkende Ungleichgewicht. Konjunkturzyklen und Krisen haben in der Regel monetäre Ursachen!
Die realen Märkte finden von selber nicht in ein Gleichgewicht, sondern entfernen sich immer mehr davon!
Das Wunder vom Ungleichgewicht auf dem Gütermarkt bei Klassikern und Neoklassikern
Da für die Klassik und die Neoklassik das Say'sche Theorem gelten soll, müsste auf dem Gütermarkt an jeder Stelle immer ein Gleichgewicht von Güterangebot und Güternachfrage herrschen. Denn jedes Angebot schaffe sich seine Nachfrage und es gäbe ja auch gar keine unbeschäftigten Arbeiter als Folge einer nicht ausreichenden Produktion und kein ungenutztes Kapital wegen des immerwährenden Kapitalmangels, mit denen diese Produktion ausgeweitet und auf der Y-Achse in ein Gleichgewicht gebracht werden könnte. Die Faktormärkte für Kapital und Arbeit sind nach der Neoklassik durch den Preismechanismus immer im Gleichgewicht und dann muss es auch der Gütermarkt sein, der Geldmarkt existiert getrennt davon nur für die Preise und hat auf den Gütermarkt keinen Einfluss.
Es gibt im Internet eine gelungene PowerPoint-Präsentation des neoklassischen Modells, dessen Betrachtung ich empfehle:
Neoklassik - Anselm Dohle-Beltinger (ppt) (MS-PowerPoint erforderlich)
Der Autor kommt mit Überzeugung zu dem Resultat: Wirtschaftskrisen sind damit unvorstellbar, wenn der Preismechanismus funktioniert ... (Folie 31)
Wundern Sie sich nicht, wenn ein Professor trotzdem Schaubilder mit Gleichgewichtskurven auf dem Gütermarkt an die Wand blendet und deren Schnittpunkte diskutieren will. Die Professoren lehren nur die Theorien der Klassik und Neoklassik und Sie haben diese Theorien in der Prüfung entsprechend darzulegen, in allen den Studenten niemals erklärten Widersprüchen und Ungereimtheiten. Mit dem Bastardkeynesianismus, der an den Universitäten gelehrt wird, kommt es nicht besser, wir werden den später auch noch behandeln. Sie wissen hoffentlich, wo Sie sich exmatrikulieren können.
Jedenfalls muss man sich nach dem Modell der Neoklassik eine Wirtschaftskrise wohl so vorstellen, dass die Arbeiter plötzlich einen wesentlich höheren Reallohn wollen und deshalb so viele von ihnen daheim bleiben, dass die Grenzproduktivität der verbliebenen Arbeiter entsprechend steigt. Nun haben wir freiwillige Massenarbeitslosigkeit, verschuldet von den Gewerkschaften.
Oder es gab ein Erdbeben und das hat so viel von dem knappen Kapital vernichtet, dass danach Arbeitsplätze fehlen und eine Anpassung an die niedrigere Kapitalausstattung der Ökonomie sich hinzieht, vor allem wegen der Arbeiter, die eine durch den Kapitalmangel erzwungene Lohnsenkung nicht hinnehmen möchten.
Ein Blick in die Geschichtsbücher ist ja kein Thema für die VWL.
Warum wir nach dem „Gesetz von Walras“ den n-ten Markt nicht betrachten sollen
Das Gesetz von Walras behauptet, dass in einem Gesamtmodell mit n zusammenhängenden Teilmärkten nur n-1 Märkte näher betrachtet werden müssten. Sind diese n-1 Märkte im Gleichgewicht, dann befindet sich auch der letzte Markt im Gleichgewicht. Aber eben nur dann!
Und warum so faul? Die neoklassische Theorie kennt doch nur drei voneinander abhängige Partialmärkte, da könnten wir uns doch die Zeit für eine ausführliche Betrachtung aller drei Märkte nehmen. Wir werden gleich sehen, warum die VWL nach der Erörterung des Arbeitsmarkts und des Kapitalmarkts die Diskussion des Gütermarkts nach Walras für überflüssig erklärt oder aber den Arbeitsmarkt und den Gütermarkt näher betrachtet und dafür vom Kapitalmarkt nichts wissen will.
Gütermarkt: Markträumung bei I = S
Arbeitsmarkt: Der Reallohn soll Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage ins Gleichgewicht bringen
Kapitalmarkt: Der Zins soll die realen Ersparnisse mit der Kapitalnachfrage für Investitionen in Übereinstimmung bringen
Oft ist noch von einem Geldmarkt die Rede, der dann der vierte Markt wäre, der aber wegen der Neutralität des Geldes in keinem Zusammenhang mit den anderen drei Märkten steht. Meist wird nur undeutlich formuliert, dass die Verkehrsgleichung den vorgeblichen Geldmarkt irgendwie beschreiben würde; jedenfalls wäre der Geldmarkt der Neoklassik ein Markt ohne Käufer und Verkäufer, dafür mit einer Geldmengenformel, aus der sich das Preisniveau ergibt. Näher lässt sich der Sachverhalt leider nicht aufklären, weil die neoklassischen Theoretiker uns das nicht verraten wollen; vermutlich suchen sie selber noch nach den genauen Zusammenhängen in ihrem Unsinn.
Mit dem Gesetz von Walras müsste es auch erlaubt sein, den Arbeitsmarkt einfach nicht näher zu betrachten, aber dann könnten die Neoklassiker nicht länger behaupten, dass die überhöhten Löhne der Grund für ein Ungleichgewicht wären, denn Gütermarkt und Kapitalmarkt müssten ja ganz ohne den Arbeitsmarkt auch zu einem Gleichgewicht finden, wenn das Gesetz von Walras zutreffen würde. Die Löhne könnten also nie das Problem sein.
Es gibt allerdings noch einen anderen Grund, warum immer nur der Kapitalmarkt oder nur der Gütermarkt diskutiert wird. Wenn Sie oben genau aufgepasst haben, mussten Sie es sehen: Gütermarkt und Kapitalmarkt haben genau dieselbe Bedingung für ein Gleichgewicht, nämlich den Zins, der die Investition mit der Ersparnis in ein Gleichgewicht bringen soll.
Eigentlich ist es aber so, dass der Gütermarkt durch den Preis in ein Gleichgewicht gebracht werden müsste, wie es im AS-AD-Modell dann auch geschieht. Nur leider kann die neoklassische Theorie mit dem Preis als Gleichgewicht für den Gütermarkt nicht dienen, weil das Geld ja neutral sein und das Preisniveau von der Geldmenge abhängen soll. Zwischen Geld und Gütern darf es überhaupt keinen Zusammenhang geben, so dass der Gütermarkt eigentlich um gar keinen Preis in ein Gleichgewicht zu bringen wäre.
Darum der Trick mit dem Gesetz von Walras: Entweder diskutiert man nur den Arbeitsmarkt mit dem Lohn und den Kapitalmarkt mit dem Zins und erklärt daraufhin sogleich, dass der Gütermarkt damit auch im Gleichgewicht sei; oder aber man diskutiert den Arbeitsmarkt mit dem Lohn und den Gütermarkt mit I = S (also dem Zins!) und verweigert jeden näheren Blick auf den Kapitalmarkt, der sich sonst gleich als Doppelgänger des Gütermarkts (oder umgekehrt) entpuppt hätte.
Genau betrachtet ist es aber noch schlimmer: Die VWL hat für ihre drei Teilmärkte sogar nur eine einzige Gleichgewichtsbedingung, den Reallohn.
Dass es ein Angebot von Ersparnissen gäbe, das sich mit dem Zins in ein Gleichgewicht mit den Investitionen bringen lässt, ist nämlich auch noch purer Unsinn. Es gibt kein Angebot von Ersparnissen, weil diese ja unbedingt mit der Nettoinvestition identisch sind und erst durch diese entstehen.
Also haben wir im neoklassischen Modell einen Kapitalmarkt ohne Angebot und einen Zins, der sich so nicht erklären lässt.
Das ist jetzt aber wirklich der letzte Einwand:
Auf dem Arbeitsmarkt soll der Reallohn für ein Gleichgewicht sorgen. Aber wie geht dies, wenn Arbeiter und Unternehmer doch nur Nominallöhne aushandeln können?
Wir bräuchten eigentlich ein Gesetz von Walras, nach dem wir besser gar keinen Teilmarkt der neoklassischen Theorie näher betrachten sollten.
Zum ihrem Glück waren die VWL-Professoren anscheinend immer zu dumm, um sämtliche Ungereimtheiten ihres neoklassischen Modells überhaupt zu bemerken, sonst hätten sie vor ihren Studenten aus Scham im Boden des Hörsaals versinken müssen. Inzwischen ist man allerdings so weit, die ehemals beliebte neoklassische Theorie des allgemeinen Gleichgewichts der Märkte nicht mehr näher zu behandeln; schließlich haben wir heute Internet, da hat sich der Käse inzwischen herumgesprochen.
Der VWL-Gütermarkt handelt mit Worten
In der klassischen Vorstellung ist das Thema am einfachsten zu diskutieren, aber es gilt auch für das neoklassische und bastardkeynesianische Modell: Mit der Diskussion des Gleichgewichts von Sparen und Investieren am Gütermarkt ist seit den Klassikern die Vorstellung von „Ersparnissen“ in realer Gestalt verbunden, die an diesem Markt von den Haushalten angeboten und von den Unternehmen zum Zweck ihrer Kapitalbildung nachgefragt werden.
Diese „Ersparnisse“ bestehen aber tatsächlich nur aus Worten und sind ein Begriff ohne materielle Gestalt. Es handelt sich nämlich bei den sogenannten „Ersparnissen“ nur um ein anderes Wort für die Nettoinvestition der Ökonomie und kein davon unabhängiges Ding. Die Ersparnis ist die Nettoinvestition aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.
In der Wirklichkeit verhält es sich so, dass die Geldpolitik die Auslastung der Ökonomie durch Konsum und Investitionen bestimmt. Es gibt also kein „Angebot von Ersparnissen“ und auch keine Nachfrage nach diesen Ersparnissen mit einem Gleichgewichtszins, sondern eine mehr oder weniger große Auslastung des Produktionspotenzials durch Konsum und Investition. Mit einer expansiven oder restriktiven Geldpolitik lässt sich der Auslastungsgrad steuern, so dass die Auslastung optimal ist, aber auch so, dass es entweder eine Inflation oder eine Rezession oder gar Depression mit Deflation gibt. Aber von der Wirklichkeit ist in der VWL keine Rede, darum gleich weiter mit dem Modellbau.
Ersparnis und Investition sind eine Tautologie
Die Unternehmen investieren einen Teil der Nettoproduktion in zusätzliche Produktionsmittel, wenn sie die Produktion rationalisieren oder ausweiten möchten. Wir erhalten die folgende Gleichung mit Y für die Nettogesamtproduktion und C für Konsum und I für die Investition:
Y = C + I
Im gleichen Zeitraum gilt selbstverständlich, dass die Differenz zwischen Y und C die „Ersparnis“ (S) der Ökonomie ist:
Y – C = S
Womit wir die folgende Tautologie erhalten:
S = I
Nun ist es eine Spezialität des VWL-Modellbaus, an dessen Märkten Tautologien und Identitäten immer wieder rege mit sich selbst oder gegeneinander gehandelt werden, die Bedingungen für ein Gleichgewicht dieses Handels zu diskutieren. Die alten Klassiker haben sich das schon so vorgestellt, dass die Haushalte ihre laufenden Ersparnisse den Unternehmen zu Investitionen anbieten und mit Zinsen für ihre Enthaltsamkeit vom Konsum belohnt und entschädigt werden. Das Gleichgewicht wurde dann durch den Zins bestimmt, bei dem die Haushalte genauso viele Ersparnisse angeboten haben, wie zu diesem Zins Investitionsmittel von den Unternehmen nachgefragt wurden.
Noch vor wenigen Jahrzehnten war diese Darstellung verbreitet, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass ein Abweichen der Ersparnis S von der Investition I ja überhaupt niemals möglich ist. Es gilt immer S = I, egal zu welchem Zins, weil ja ganz trivial immer C = C und Y = Y gelten muss, was die Ökonomen nicht nur einige Zeit und Geisteskraft gekostet hat, sondern immer noch nicht allgemein anerkannt ist. In der aktuellen Ausgabe Grundzüge der Volkswirtschaftslehre von Mankiw/Taylor, Stuttgart 2012, wird der Kreditmarkt wieder so diskutiert, als würden durch einen Konsumverzicht der Haushalte Ersparnisse entstehen, die an Investoren verliehen werden, wobei der Zins Ersparnis und Investition zur Übereinstimmung bringen soll, obwohl es ohne Investition gar keine Ersparnis gibt. Hier können Sie den berühmten Gregory Mankiw bei der Erfindung des Gleichgewichts von Identitäten erleben:
Der Zinssatz passt sich an, um das Angebot an und die Nachfrage nach Kreditmitteln in einer Volkswirtschaft in Übereinstimmung zu bringen. Das Angebot an Kreditmitteln stammt aus der nationalen Ersparnis ...
Mankiw/Taylor, 2012, S. 693, Schaubild 26-1
Im Lehrbuch von Olivier Blanchard und Gerhard Illing, Makroökonomie, 5. Auflage, München 2009, sieht es nicht besser aus. Als Gleichgewichtsbedingung für den Gütermarkt soll entweder die Güterproduktion Y gleich der Güternachfrage Z sein (S.93) oder aber die Investition gleich der Ersparnis (S. 102). Da müssen wir allen Ernstes lesen:
Ein alternativer, aber äquivalenter Ansatz betrachtet die Gleichheit von Investition und Ersparnis. Dies ist der Weg, den erstmals John Maynard Keynes 1936 in seinem Buch "The General Theory of Employment, Interst and Money" formulierte.
Blanchard/Illing, ebenda, S. 102
Keynes hat jedoch bewiesen, dass die Ersparnis immer mit der Investition identisch ist. Da könnten wir ebenso gut als Gleichgewichtsbedingung statt I=S zum Beispiel 1+1=2 oder 2+2=4 wählen. Selbstverständlich ist auch die Produktion immer gleich der Nachfrage, denn wenn ein Produkt nicht verkauft werden kann, dann wurde es entweder auf Lager produziert - und damit von dem Unternehemen selbst nachgefragt - oder es muss abgeschrieben werden und zählt nicht zur Produktion. Ob Boom oder Krise, die Unternehmen müssen bei ihrer Produktion immer die Nachfrage beachten; auch im Jahr 1932 war die Produktion gleich der Nachfrage, deshalb waren so viele Menschen arbeitslos. Der Gütermarkt wäre also nach Blanchard/Illing immer im Gleichgewicht - aber was erzählen die ihren Studenten, wie der Gütermarkt ins Gleichgewicht kommt, wenn doch immer die Produktion gleich der Nachfrage ist und die Ersparnis identisch mit der Investition?
Nach meiner Kenntnis hat Keynes erstmals die absolute und triviale Identität von Investition und Ersparnis festgestellt und saldenmechanisch damit begründet, dass immer ein Käufer mit einem Verkäufer handelt:
Die Gleichheit der Summe der Ersparnis und der Summe der Investition ergibt sich aus dem zweiseitigen Wesen der Transaktionen zwischen dem Erzeuger einerseits und dem Verbraucher oder Käufer der Kapitalausrüstung andererseits. ... Der gesamte Überschuß von Einkommen über Verbrauch, von uns Ersparnis genannt, kann daher nicht von der Hinzufügung zur Kapitalausrüstung abweichen, die wir Investition nennen. ... Angenommen, die Entscheidungen, zu investieren, werden umgesetzt, so muß entweder der Verbrauch eingeschränkt oder das Einkommen vergrößert werden. Der Akt der Investition muß für sich somit unbedingt das Residuum oder die Spanne - was wir Ersparnis nennen - um einen entsprechenden Betrag erhöhen.
Keynes, Allgemeine Theorie, Berlin 1936/2006, S. 56.
Nur an der oberen Auslastungsgrenze des Produktionspotenzials wäre genau im Umfang der Investitionen real am Konsum zu sparen. Hier hat der Begriff der Ersparnis dann einen anderen Sinn: Es geht nicht um I = S, sondern um die Gefahr einer preistreibenden Übernachfrage nach Gütern, die von der Geldpolitik zu vermeiden wäre. Im Bereich der Unterauslastung, der ja eher der übliche Fall in der Wirtschaftsgeschichte ist, braucht für Investitionen am Konsum nicht gespart zu werden.
Das Gütermarktgleichgewicht als Hirngespinst
Mit der Erkenntnis, dass es sich bei Ersparnis und Investition um eine Tautologie handelt, war der VWL-Modellbau wieder so weit wie mit dem Say'schen Theorem, dass ein Ungleichgewicht auf dem Gütermarkt gar nicht auftreten kann. Damit wäre der umständliche VWL-Modellbau über das Thema, wie die Märkte immer wieder ganz von selber in ein wunderbares Gleichgewicht finden, völlig ohne jeden Sinn.
Aber man soll die Professoren nicht unterschätzen. In größter Not ist ihnen ein genialer Gedanke gekommen, wie das Gütermarktgleichgewicht (statt des Auslastungsgrades des Produktionspotenzials) doch noch zu diskutieren wäre, nämlich als reines Hirngespinst von geplanter Ersparnis und geplanter Investition. Die Bedingung für das wunderbare Gleichgewicht am Gütermarkt lautet demnach:
I* = S*
(mit I* = geplanter Investition und S* = geplanter Ersparnis)
Die Sache hat nur drei Schönheitsfehler: Niemals und mit keiner Methode kann festgestellt werden, ob sich der Gütermarkt nun gerade in einem Gleichgewicht dieser „geplanten“ Investitionen und Ersparnisse befindet oder nicht. Das ist der erste Fehler und wäre noch nicht so schlimm.
Zweitens wird die Frage nach der Auslastung des Produktionspotenzials immer noch nicht gestellt: Wir brauchen auch keine geplante Ersparnis bei Unterbeschäftigung und die Haushalte werden sich nicht beschweren, wenn die Konjunktur besser läuft als geplant und ihre Einkommen und Ersparnisse dabei gestiegen sind.
Vor allem aber gilt, dass sämtliche Haushalte wie Unternehmen für die Planung ihrer Investitionen und Ersparnisse die genaue Voraussicht der Entwicklung der Ökonomie haben müssten, um dann genau den Umfang an Ersparnis und Investition zu planen, der die Bedingung für das Gleichgewicht des Gütermarktes erfüllt.
Das kann die Professoren aber nicht abhalten, die längsten und schönsten Gleichgewichtskurven zu malen, in denen sich die „geplanten“ Ersparnisse mit den „geplanten“ Investitionen im Gleichgewichtszinssatz schneiden. Wozu besitzen die Studenten denn ihre Phantasie und Vorstellungskraft?
Dabei handelt es sich selbst im Gleichgewicht immer um Mittelwerte: Die meisten Sparer hätten lieber mehr gespart, aber das dafür erhoffte Einkommen nicht erreicht, die Investoren hätten fast immer gern mehr netto investiert, aber der Markt hat es vereitelt. Selbst wenn die geplanten Ersparnisse und Investitionen zufällig im Durchschnitt erreicht worden wären, hätten Investoren wie Haushalte bei anderen Konjunkturaussichten anders geplant. Die Suche nach dem Gleichgewicht ist eine Jagd nach einem Phantom und soll die Studenten nur von dem einzigen wirklich wichtigen Gedanken abhalten, dass nämlich die optimale Auslastung der Ökonomie das Ziel sein müsste und die dafür geeignete Geld- und Finanzpolitik zu diskutieren wäre und nicht Gleichgewichtskurven über einer Y-Achse, die sich dann noch ständig verschieben durch externe Schocks oder geänderte Vorlieben der Haushalte.
Die Gleichgewichtsbedingung für den Gütermarkt, dass geplante Ersparnisse und geplante Investitionen jemals übereinstimmen, muss wegen der dafür erforderlichen totalen Vorhersehbarkeit der ökonomischen Entwicklung durch alle Beteiligten als grundsätzlich unerfüllbar angesehen werden.
Warum die Ökonomie nur bei optimaler Auslastung im Gleichgewicht sein könnte
Die Modelle der herrschenden Lehre setzen voraus, dass die Vertreter der Unternehmen und Haushalte mindestens so dumm sind, wie die Professoren und Studenten der VWL, und auch bei einer Unterauslastung der Ökonomie mit dem Zustand zufrieden sind und keinen Grund sehen, etwas daran zu ändern. Denn im Gleichgewicht sollen ja immer alle Beteiligten mit dem Ergebnis am Markt, also den Mengen und Preisen, optimal bedient sein und keine Möglichkeit sehen, sich besser zu stellen:
Zu höheren Preisen würde keine größere Menge nachgefragt und zu niedrigeren Preisen würde keine größere Menge angeboten.
Bei einer Unterauslastung des Produktionspotenzials könnte nur ein Gleichgewicht der Ignoranz herrschen, weil Anbieter wie Nachfrager durch eine steigende Auslastung besser gestellt werden könnten. Das Postulat eines Gleichgewichts unter der optimalen Auslastung muss also unterstellen, dass Anbieter wie Nachfrage den Zustand nicht ändern wollen, weil sie zu dumm sind, die Möglichkeit einer höheren Auslastung mit besseren Einkommen und höheren Ersparnissen geistig zu erfassen, oder keinen geeigneten Weg sehen, die für die Krise verantwortliche Geld- und Finanzpolitik zu beeinflussen.
Der Kapitalmarkt im VWL-Modellbau
Wegen der angeblichen Neutralität des Geldes ist es wichtig, dass die Investoren am Modell-Kapitalmarkt nicht etwa Kredit nachfragen, sondern "reale Ersparnisse" der Haushalte. Würden die Investoren Kredit nachfragen, ließe es sich kaum verheimlichen, dass eine expansive Geldpolitik die Investitionen fördert und eine restriktive Kreditpolitik diese abwürgen kann, dass ferner die Kreditaufnahme von der erwarteten Entwicklung der Preise beeinflusst wird, also vom Realzins, und dass schließlich keine Ersparnisse der Haushalte verliehen werden, sondern die volkswirtschaftliche Ersparnis durch die erfolgreiche Nettoinvestition erst entsteht.
Dass Ersparnisse der Haushalte für Investitionen benötigt und auf dem Kapitalmarkt gehandelt würden, ist aber eine wichtige These der VWL. Denn nur so kann das Say'sche Theorem gelten, weil die Haushalte vorher an der Güternachfrage sparen mussten, um ihre reale Ersparnis dann den Unternehmen für Investitionen anbieten zu können. An der Gesamtnachfrage kann sich also weder durch das Sparen noch durch das Investieren irgendetwas ändern, die Gesamtnachfrage nach Gütern bleibt immer konstant.
Falls der Professor dieses Phänomen der realen Ersparnis überhaupt näher erklärt, wird es meist mit einem Ein-Güter-Modell veranschaulicht:
In einer Ökonomie werde nur Korn produziert und diene zum Konsum wie für die Investition als Saatgut zur nächsten Ernte. Weil die Haushalte ihr Korn lieber gleich essen möchten, muss ihnen ein Zins angeboten werden, damit sie einen Teil davon sparen, der im nächsten Jahr als Saatgut dient.
So zweifelt der Student nicht länger an der Existenz realer Ersparnisse von Körnern, die am Körner-Kapitalmarkt gehandelt werden können. Denn das Korn wächst auf dem Feld unabhängig vom Umfang der Güternachfrage und von der Geldpolitik. Es wächst bei hohen Zinsen nicht weniger und bei niedrigen Zinsen nicht mehr und wenn es schon einmal gewachsen ist, dann bringt der Bauer es zur Ernte auch vollständig ins Lager und lässt es nicht mutwillig auf den Feldern verrotten. Oder doch? Aber dafür müsste man sich erst mit der Wirtschaftsgeschichte näher beschäftigen, im Modell ist das ganz undenkbar.
Der Konsumverzicht führt also immer zu Ersparnissen in realen Säcken voller Körner, die dringend als Saatgut gebraucht werden, und nicht zum Bankrott der Farmer, bei hungernder Bevölkerung. Dass Farmer bankrottieren, obwohl - oder gerade weil - alle Farmer eine prächtige Ernte eingebracht haben und die Scheuern voll mit Korn sind, die Menschen aber kein Geld haben, es zu verbrauchen, weil die Notenbank mit Hochzinspolitik die Nachfrage abwürgt, das wird im Modell nicht vorgesehen und das kann es deswegen im Modell auf gar keinen Fall geben. Das Geld ist ja neutral und kommt auch am Kapitalmarkt gar nicht vor, weil da nur Körner - reale Ersparnisse - gehandelt werden, und Banken können keine Körner, sondern nur Geld als Kredit "aus dem Nichts" schöpfen.
Was die VWL als Kapitalmarkt diskutiert, das ist kein Kapitalmarkt, sondern heißt nur so. Für einen Kapitalmarkt bräuchte es Geld und ein Kredit schöpfendes Bankensystem.
Konjunkturgleichung und monetärer Konjunkturmechanismus
Die Volkswirtschaftslehre verwirrt ganz gezielt und beabsichtigt ganz verschiedene Arten des Sparens. Dem Publikum ist in der Regel das Sparen von Geld geläufig und es meint überwiegend auch das Geldsparen, wenn von Sparen die Rede ist. Das Publikum versteht unter Sparen in der Regel Einnahmeüberschüsse, also weniger Geld ausgeben, als man eingenommen hat. In einer Volkswirtschaft kann der Reichtum durch das Sparen von Geld jedoch nicht steigen, weil ein Sektor der Ökonomie nur Einnahmeüberschüsse erzielen kann, wenn ein anderer Sektor in genau dieser Höhe Ausgabenüberschüsse tätigt. Es gilt ja immer Schulden = Forderungen, steigende Geldvermögen sind also nur mit steigender Verschuldung möglich und der Saldo bleibt immer Null.
Der Reichtum einer Volkswirtschaft kann nur durch einen (ausgelasteten) Kapitalstock steigen. Das Sparen einer Volkswirtschaft erfolgt also mit Nettoinvestitionen zur Vergrößerung des Kapitalstocks wie Gebäude, Maschinen, Vorräte. Ein Wachsen des Kapitalstocks erfordert ein wachsendes Sozialprodukt zu dessen Auslastung. Ein Konsumverzicht wäre nur in einem Ausnahmefall sinnvoll, wenn die Ökonomie in voller Auslastung an der Grenze des Produktionspotentials produziert und der Konsum weniger werden muss, um zusätzliche Investitionen zu ermöglichen.
Wegen des mikroökonomischen Denkens der Mehrheit des Publikums ist die falsche Vorstellung verbreitet, dass auch in einer Krise, also bei Unterauslastung des Kapitalstocks, hart gespart werden müsse, damit dann mehr investiert werden könne. In allen diesen Fällen werden Investitionen nicht zu einem wachsenden Kapitalstock führen, also keine Nettoinvestition werden, sondern höchstens konkurrierendes Kapital vernichten. Konsumverzicht ist also in aller Regel genau die falsche Maßnahme, um die volkswirtschaftliche Ersparnis (= Nettoinvestition) zu erhöhen. Der mikroökonomisch denkende Mensch kapiert das nicht, weil für ihn privat durch Konsumverzicht immer eine höhere Ersparnis aus seinem Einkommen erzielt werden kann, solange er noch ein Einkommen hat.
Das Sparen von Geld erfordert immer eine zusätzliche Verschuldung; das Sparen der Privaten erfordert die wachsende Verschuldung der Wirtschaft oder des Staates (vom Ausland wollen wir zur Vereinfachung absehen). Das ist im Prinzip ganz einfach zu verstehen:
Schulden = Geldvermögen
Geldvermögen ist hier allein im Sinne von Geldforderungen gebraucht, also ohne Aktien und andere Verwirrspiele. Die VWL hat diese Konjunkturgleichung bis heute ganz übersehen. Denn aus dieser ganz trivialen saldenmechanischen Gleichung erhalten wir die Erklärung für den monetären Konjunkturmechanismus:
Wenn der Staat sich nicht verschuldet, z.B. weil die VWL-Professoren den Haushaltsausgleich in der Krise fordern, dann kann der Sektor Private (Haushalte und ihre Unternehmen) im Saldo kein Geld sparen.
Ohne Staatsverschuldung muss der Sektor der Privaten (Haushalte und ihre Unternehmen) in einer Krise ohne Nettoinvestition so stark verarmen, dass ihm keine Nettoersparnis von Geld mehr möglich ist. Je mehr sich der Staat verschuldet, desto weniger muss der Sektor der Privaten in einer Krise verarmen. Ein das Existenzminimum übersteigendes Einkommen des privaten Sektors wird also in der Krise durch die Verschuldung des Staates ermöglicht und im normalen Verlauf der Konjunktur und bei entsprechend niedrigen Zinsen durch die freiwillige Verschuldung von Investoren und Konsumenten, das ist die ganze Grundlage des monetären Konjunkturprozesses und des Multiplikators nach Keynes.
Die monetäre Krisenfalle
In einer Makroökonomie muss immer gelten:
Ausgaben => Einnahmen
Das erscheint zunächst trivial, ist es aber nicht. Ihre Ausgaben sind meine Einnahmen und meine Ausgaben sind Ihre Einnahmen. Die Einkommen in einer Ökonomie entstehen durch die Ausgaben in dieser Ökonomie und sind in jedem Zeitraum T(1,2,3...) genau gleich. Damit die Ökonomie nicht schrumpft, real wie nominal, müssen im Zeitraum T(2) die Ausgaben und Einnahmen mindestens so hoch sein wie im vorangegangenen Zeitraum T(1).
Einnahmen = Ausgaben
Nun kann es sein, dass ein Teil der Haushalte aus seinem Einkommen einen Überschuss an Geld erhalten will, er senkt also die Ausgaben unter die Einnahmen und erzielt so einen Einnahmeüberschuss. In einem Land mit größerem Wohlstand ist das immer leicht möglich, seine Ausgaben unter die Einnahmen zu senken. Wie wir oben sehen ist ein Einnahmeüberschuss eines Teils der Haushalte (Sektor A) jedoch nur möglich, wenn es gleichzeitig einen Ausgabenüberschuss anderer Haushalte (von Privaten oder Staat: Sektor B) gibt. Es gilt immer:
Einnahmeüberschuss (Sektor A) = Ausgabenüberschuss (Sektor B)
Die beliebte Vorstellung der Schwäbischen Hausfrauen unter unseren Politikern, dass die Wirtschaft reibungslos läuft, wenn jeder sparsam ist und nicht mehr ausgibt, als er einnimmt, die Privaten wie der Staat, führt auf dem direkten Weg in eine mörderische deflationäre Depression. Das wird selbstverständlich von den Massenmedien angeheizt und sie können jede Wirtschaftskrise ganz ohne jede Statistik des BIP schon allein daran erkennen, dass die Massenmedien, Politiker und VWL-Professoren ständig das Sparen fordern und die Krise damit begründen, dass unverantwortliche Leute und die Regierung über ihre Verhältnisse gelebt hätten und ihre Ausgaben ständig ihre Einnahmen überstiegen.
Genau dies, dass alle sparen wollen und niemand mehr ausgeben will, als er einnimmt, ist die Ursache der Depression der Wirtschaft. Denn jetzt, wenn der Sektor B seine Verschuldung auf Null zu senken versucht, muss die Wirtschaft so stark einbrechen, dass die Einkommen des Sektors A so niedrig sind, dass niemandem mehr Geld zum SPAREN übrig bleibt. Der gesamte Wohlstand dieser Ökonomie muss verschwinden, die Menschen müssen verarmen, damit den Leuten nur noch das Nötigste zum Leben bleibt und fast niemand mehr seine Ausgaben unter die Einnahmen zu senken vermag. Das und nur das ist die Ursache der Krisen:
Der Bestand an Kapital und das Niveau der Beschäftigung werden folglich schrumpfen müssen, bis das Gemeinwesen so verarmt ist, daß die Gesamtersparnis Null geworden ist, so daß die positive Ersparnis einiger Einzelner oder Gruppen durch die negative Ersparnis anderer aufgehoben wird. In einer unseren Annahmen entsprechenden Gesellschaft muss das Gleichgewicht somit unter Verhältnissen des laissez-faire eine Lage einnehmen, in der die Beschäftigung niedrig genug und die Lebenshaltung genügend elend ist, um die Ersparnisse auf Null zu bringen.
Keynes: Allgemeine Theorie, Berlin 1936/2006, S. 183
Der Staat kann für den Sektor B einspringen und durch seine Verschuldung die Verarmung der Ökonomie aufhalten. Verschuldet sich der Staat, dann können die Privaten noch ein entsprechend höheres Einkommen erzielen, das ein Sparen von Geld (Einnahmeüberschüsse) im Umfang des Staatsdefizits zulässt. Verschuldet sich der Staat nicht, dann muss die Ökonomie so schlecht laufen und die Bürger müssen so sehr verarmen, dass im Saldo jeder sein ganzes Geld ausgeben muss und kein Einnahmeüberschuss mehr gebildet werden kann.
Die monetäre Ursache der Krisen ist also ganz einfach, aber erklären Sie das einmal den nur mikroökonomisch denkenden Bürgern und unseren Schwäbischen Hausfrauen in der Regierung. Und raten Sie mal, warum unsere sogenannte Wirtschaftswissenschaft diese Ursache aller Absatzkrisen noch nicht entdeckt hat und Sie bei einem VWL-Studium davon nichts erfahren.
Die keynesianische Sparfunktion und der Multiplikator
Im folgenden Kapitel ist von Einnahmeüberschüssen die Rede, also vom Sparen von Geld. Bei den VWL-Professoren ist dagegen nie klar, von welchem "Sparen" sie denn gerade reden, wenn sie die Sparfunktion von Keynes behandeln. Ein Sparen in Gestalt von Nettoinvestitionen bei einem wachsenden Kapitalstock ist in einem Boom möglich und dann gibt es auch keinen Multiplikator für hohe Staatsdefizite, sondern höhere Inflation. Wir behandeln aber hier die Unterauslastung des Kapitalstocks in Krisenzeiten, in denen das Staatsdefizit eine hohe Multiplikatorwirkung für die reale Güternachfrage und Produktion hat.
Von Keynes haben die Ökonomen dessen These übernommen, dass die Ersparnis in einer Ökonomie eine Funktion des Einkommens ist. Steigende Einkommen sind also mit einer höheren Ersparnis verbunden. Wird diese Sparfunktion graphisch dargestellt, dann haben wir ausgehend vom Nullpunkt (Einkommen = 0) bis zum Punkt A (alles Einkommen wird für den Konsum ausgegeben) eine negative Ersparnis, die Leute leben also von ihren Ersparnissen und geben mehr aus als sie verdienen.
Für die höheren Einkommen rechts vom Punkt A können wir nun eine Konsum- und Sparquote annehmen, zum Beispiel dass 80% des zusätzlichen Einkommens für den Konsum ausgegeben und 20% gespart wird. Natürlich wäre es auch denkbar, dass die Sparquote selbst mit stark steigenden Einkommen wächst und dann 30% oder 40% und mehr des zusätzlichen Einkommens beträgt. Vor allem ist zu berücksichtigen, dass in einer Ökonomie die Einkommen nicht gleich verteilt sind und so die Sparquote der gesamten Ökonomie auch von der Einkommensverteilung abhängt: Je höher die Einkommensquote der Reichen, desto höher die Ersparnisse der gesamten Ökonomie.
Während die Ökonomen soweit der Darstellung von Keynes folgen, hapert es bei ihnen mit den ganz trivialen Schlussfolgerungen. Daher will ich hier zeigen, wie das Einkommen einer Ökonomie von der möglichen Ersparnis und damit auch von den Staatsausgaben und vor allem dem Deficit Spending des Staates abhängt.
In einer Wirtschaftskrise haben wir eine starke Unterauslastung des Produktionspotentials und daher keine Nettoinvestition in einen wachsenden Kapitalstock. Deshalb muss auch die Ersparnis des privaten Sektors (Haushalte und private Unternehmen) in der Summe Null sein oder wegen der Kapitalvernichtung durch Unterauslastung sogar negativ. Daraus ergibt sich, dass das gesamte Einkommen (BIP/GDP) der Ökonomie sinken muss und zwar mindestens auf den Punkt A und sogar links davon. Denn rechts von diesem Punkt A würde ja zusätzlich aus den erzielten Einkommen gespart werden, was aber makroökonomisch gar nicht möglich ist.
Tatsächlich sorgen in Wirtschaftskrisen die einbrechenden Gewinne, die Verluste aus den laufenden Geschäften und die Vernichtung von Kapital für stark fallende Einkommen der Ökonomie. Die letzten laufenden Ersparnisse von Rentiers fallen wenn nötig noch dem Crash der Banken zum Opfer, bis eben tatsächlich das Einkommen in der Ökonomie (BIP/GDP) auf den Bereich links von Punkt A gesunken ist. Durch große Kapitalverluste könnte es sogar zu einem negativen GDP unter dem Nullpunkt kommen, wenn das die Statistiker entsprechend berechnen würden.
Falls die Ökonomie sich in einer schweren Wirtschaftskrise befindet, in der mangels Auslastung des Produktionspotentials keine reale Ersparnis durch Nettoinvestitionen möglich ist, wäre die einzig mögliche Ersparnis noch durch steigende Geldvermögen möglich. Wir beginnen die Betrachtung ohne Staat und damit ohne Staatsverschuldung (und zur Vereinfachung ohne das Ausland). Offensichtlich muss das Einkommen des Sektors Privat so tief fallen, dass keine Nettoersparnis mehr erfolgt:
Y = A
Bis jetzt haben wir nur die privaten Haushalte betrachtet und wollen nun den Sektor Staat in unsere Überlegungen einbeziehen. Der Staat erhebt von den Privaten Steuern und senkt damit das verfügbare Einkommen, aus dem die Privaten sparen können. Wir erhalten nun das überraschende Ergebnis, dass das von der Sparfunktion abhängige Gesamteinkommen (BIP/GDP) um den Gesamtbetrag der Steuern T wächst, sofern die Staatsausgaben gleich den gesamten Steuereinnahmen sind, der Staat also nicht spart.
Y = A + T
Die Staatsausgaben, finanziert durch Besteuerung, haben in diesem Fall einen Mulitplikator von 1. Jeder zusätzlich durch Besteuerung (der sparenden Reichen statt der nicht sparenden Armen) eingenommene und sinnvoll (also konsumfördernd bei den Bedürftigen und nicht für das Kapital und die Reichen) wieder ausgegebene Euro ermöglicht ein Wachstum der Ökonomie um genau diesen Euro.
Steuersenkungen in Krisen sind also krisenverschärfend!
Was die VWL-Professoren im Gegensatz zu ihrem Publikum auch genau wissen, deshalb fordern sie ständig in Krisen Steuersenkungen für die Reichen und Ausgabenkürzungen bei den Armen, womöglich sogar die Besteuerung der Armen, die ihr Einkommen vollständig konsumieren, zur Finanzierung von Steuergeschenken und Subventionen für die Reichen, deren Sparfähigkeit damit wächst, wodurch das nach der Sparfunktion mögliche Einkommen der Ökonomie weiter fallen muss.
Kommen wir zum staatlichen Deficit Spending, wobei eine Konsumquote von 80% des zusätzlichen Einkommens gelten soll:
Der Staat erhöht also seine Ausgaben G über seine Einnahmen T hinaus auf Kredit. Wir befinden uns gemäß unseren Annahmen immer noch in einer schweren Krise, das Produktionspotential ist nicht ausgelastet, es gibt keine Nettoinvestition und keine Nettoersparnis dieser Ökonomie. Die Privaten können jetzt aber in Höhe des Deficit Spending durch den Staat zusätzliche private Ersparnisse bilden und deshalb können die Einnahmen in der Ökonomie entsprechend steigen. Bei einer Sparquote von 20% gilt für das Einkommen der Ökonomie:
BIP/GDP = Y = A + T + 5x(G - T)
Wir erhalten also einen Multiplikator für zusätzliche und kreditfinanzierte Staatsausgaben in der Höhe eines Faktors von 5: Für jeden zusätzlich vom Staat auf Kredit ausgegebenen Euro kann das Einkommen der Ökonomie (BIP/GDP) um 5 Euro steigen.
Aus genau dem Grund fordern VWL-Professoren in Wirtschaftskrisen immer einen krisenverschärfenden Haushaltsausgleich, einen Abbau der öffentlichen Defizite oder gar einen Abbau der Staatsverschuldung durch Überschüsse im Haushalt. Denn für jeden eingesparten Betrag im öffentlichen Haushalt muss die Ökonomie das um den Multiplikator gesteigerte Vielfache der Einsparungen an BIP/GDP verlieren. Das Einkommen der Privaten sinkt in unserem Beispiel um das Fünffache der staatlichen Sparmaßnahmen!
Der neoklassische Arbeitsmarkt ohne Erklärung für die Krisenarbeitslosigkeit
Im Gegensatz zu den Vorstellungen der Klassiker orientieren sich im neoklassischen Modell die Löhne nicht am Existenzminimum und die Lohnschwankungen beeinflussen nicht mehr über Lebenserwartung und Kindersterblichkeit die Höhe des Arbeitsangebots.
Die Vorstellungen der Neoklassik werden durch die Grenzproduktivität geprägt. Bei einer gegebenen Kapitalausstattung sinkt mit jedem zusätzlichen Arbeiter dessen Grenzprodukt. Die Grenzproduktivität des letzten zusätzlichen Arbeiters bestimmt den allgemeinen Reallohn. Für die Kapitalrendite gilt das Prinzip der Grenzproduktivität ebenfalls: Bei einer gegebenen Zahl von Arbeitern sinkt das Grenzprodukt zusätzlich eingesetzten Kapitals. Das Grenzprodukt des letzten zusätzlich eingesetzten Kapitals bestimmt die Kapitalrendite.
Im neoklassischen Arbeitsmarkt steigt das Arbeitsangebot mit steigendem Reallohn (Nominallohn/Preisniveau => w/p), während die Arbeitsnachfrage mit steigenden Reallöhnen sinkt. Der Arbeitsmarkt ist im Gleichgewicht bei einem Reallohn w/p, der genau der sinkenden Grenzproduktivität einer entsprechenden Zahl von Arbeitern entspricht, die zu diesem Reallohn arbeiten wollen. Wollen zusätzliche Arbeiter eine Arbeit, müssen die Arbeiter wegen der sinkenden Grenzproduktivität einen niedrigeren Reallohn akzeptieren.
Arbeitslosigkeit ist im neoklassischen Modell immer freiwillig, weil zu einem niedrigeren Reallohn jeder (im Modell!) eine Arbeit finden kann, der zu diesem Lohn zu arbeiten bereit ist. Im Gegensatz zur Realität führen einbrechende Löhne nicht zu einer die Krise verschärfenden Deflation und noch mehr Erwerbslosen durch sinkende Kaufkraft und in Erwartung weiter fallender Preise ausbleibende Investitionen, weil der Modell-Arbeitsmarkt einen mikroökonomischen Trugschluss darstellt.
Die Produktion Y wird durch die Zahl der Arbeiter bestimmt, die für den durch die Grenzproduktivität bestimmten Marktlohn arbeiten wollen. Die Produktion kann gesteigert werden, wenn mehr Arbeiter bereit sind, für einen geringeren Lohn zu arbeiten. Daher fordert die Neoklassik, diese Arbeitsbereitschaft durch den Abbau von Sozialleistungen und vor allem die Abschaffung der Arbeitslosenunterstützung zu steigern. Arbeiter sollen gezwungen werden, niedrigere Löhne zu akzeptieren.
Die Weltwirtschaftskrise 1929-33 hat bewiesen, dass sinkende Löhne eine deflationäre Depression verschärfen und die Lohnsenkungen nicht zur Vollbeschäftigung führen. Der Grund ist die prozyklische Anpassung der realen Märkte mit echtem Geld, das nicht neutral ist. Inflation wie Deflation werden durch die Marktkräfte verstärkt.
Die Senkung der Nominallöhne führt in einer Absatzkrise zu sinkender Kaufkraft, sinkenden Preisen und der Erwartung weiter sinkender Preise, also zu deshalb niedrigen Investitionen. Die Neoklassik kann nicht erklären, wie und warum die Löhne stärker sinken könnten, wenn die Preise ebenfalls sinken, wie es also überhaupt zu niedrigeren Reallöhnen kommen soll. Tatsächlich werden zwischen Arbeitern und Unternehmen keine Reallöhne vereinbart, sondern Nominallöhne. Wie hoch der Lohn dann real ausfällt, wird durch die Preisentwicklung entschieden. Auf die haben aber die Arbeiter keinen Einfluss und können daher gar nicht zu irgendwelchen Zugeständnissen beim Reallohn bereit sein oder diese verweigern.
Das neoklassische Modell kennt allerdings gar keinen Zusammenhang zwischen sinkenden Nominallöhnen und dadurch sinkenden Preisen, weil die Preise ja von der Geldmenge abhängig seien. Es kennt auch keinen Zusammenhang zwischen der Höhe der Löhne und der Kaufkraft und Güternachfrage. Nur aus diesen Gründen kann die Neoklassik wie schon vorher die Klassik ganz naiv und dumm von niedrigeren Löhnen eine höhere Beschäftigung erwarten.
Vor allem aber kann der neoklassische Modell-Arbeitsmarkt keine Erklärung dafür liefern, warum die von einer Wirtschaftskrise freigesetzten Arbeitskräfte noch vor der Krise alle real und nominal zu höheren Löhnen beschäftigt waren und in der Krise plötzlich selbst zu weit niedrigeren Löhnen keine Arbeit mehr finden. Die Arbeitslosigkeit wird in Krisen ja nicht mit Lohnerhöhungen, sondern mit Zinserhöhungen der Notenbank oder durch einen Börsenkrach und eine Finanzkrise verursacht. Diese Themen kommen im neoklassischen Modellbau nicht vor.
Die VWL-Professoren diskutieren weder das Problem weiter sinkender Preise durch sinkende Löhne noch die höheren Löhne zum Zeitpunkt vor dem Ausbruch der Krise, sondern geben ganz dreist den Gewerkschaften und den Tarifverträgen die Schuld an den angeblich überhöhten Reallöhnen und der angeblich damit verschuldeten Arbeitslosigkeit. Mit diesen Behauptungen treten die VWL-Professoren dann täglich in den Medien auf und hetzen gegen Gewerkschaften und Tarifverträge als Ursache von Krisen und Erwerbslosigkeit. Dafür werden den Professoren vom Kapital Forschungsinstitute zur "Zukunft der Arbeit“, dass also die Arbeiter flexibler und billiger werden müssten, und die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in den kapitalistischen Medien bezahlt.
Die neoklassische Arbeitsmarkt-Theorie und der angebliche Kapitalmangel
Die neoklassische Arbeitsmarkt-Theorie hat zur Voraussetzung den Kapitalmangel. Es gibt (als Beispiel) nur 1 Maschine für 10 Arbeiter. Wenn man nun 20 oder 100 Arbeiter beschäftigen will, dann stehen die sich an der nur 1 Maschine gegenseitig im Weg und sind nicht mehr so produktiv. Bei 20 Arbeitern kann man noch eine Nachtschicht einführen, aber nachts sind die Arbeiter nicht mehr so gut drauf und die Maschine muss auch mal gewartet werden, daher ist mehr Beschäftigung nur zu niedrigeren Löhnen möglich. Spätestens bei 100 Arbeitern ist jeder zusätzliche Arbeiter kaum noch von zusätzlichem Wert.
Deshalb und nur deshalb müssen in der neoklassischen Arbeitsmarkt-Theorie für mehr Beschäftigung die Löhne sinken!
Weil es ja (in unserem Beispiel) nur 1 Maschine für die 10+X Arbeiter gibt wegen des angeblichen Kapitalmangels im Modell. An der nur einen Maschine ist jeder zusätzliche Arbeiter also immer weniger produktiv und kann nur für entsprechend weniger Lohn beschäftigt werden. Würde für zusätzliche 10 Arbeiter eine zusätzliche Maschine aufgestellt, dann müsste die Grenzproduktivität der Arbeit überhaupt nicht sinken und zusätzliche Arbeiter dürften den gleichen Lohn erhalten. Damit entfiele auch jede Begründung für die Lohnhöhe im neoklassischen Modell.
Aus dem angeblichen Kapitalmangel wird auch der Anspruch auf Zins und Profit hergeleitet, der als Belohnung für das Sparen dient, weil man sich zusätzliche Maschinen für die 100 Arbeiter ja erst vom Mund (Konsum) absparen muss. Ohne die Geschichte mit der nur 1 Maschine für die 10+x Arbeiter entfällt auch die Begründung für Zins und Profit im neoklassischen VWL-Modellbau.
In der realen Ökonomie gibt es natürlich überhaupt keinen Kapitalmangel, sondern höchstens einen Absatzmangel. Es ist also kein Problem, für die nächsten und übernächsten 10 Arbeiter auch eine eigene Maschine hinzustellen. Im Gegenteil! Aber die Nachfrage nach zusätzlichen Gütern fehlt. Zusätzliche Güter müssten billiger oder sogar sehr viel billiger verkauft werden, meist geht die Ausweitung der Produktion aber gar nicht oder es macht dafür eine andere Firma dicht.
Die beispielhafte Geschichte mit der nur 1 Maschine für die 10+X Arbeiter ist nun die ganze Grundlage für die neoklassische Arbeitsmarkt-Theorie (die übrigens auch für das bastardkeynesianische IS/LM-Modell gilt).
Nur deswegen gibt es in der VWL eine sinkende Grenzproduktivität der Arbeit!
Nur darauf beruht die berüchtigte Forderung nach sinkenden Löhnen für mehr Beschäftigung!
Übrigens ist die Ungültigkeit des Say'schen Theorems identisch mit der Ungültigkeit der These vom Kapitalmangel:
Denn gäbe es einen Kapitalmangel, müsste die Ökonomie ja immer allein schon damit voll ausgelastet sein, das (angeblich) fehlende Kapital zu produzieren.
Der Bastardkeynesianismus
John Maynard Keynes hat in den 1920er Jahren mit zahlreichen Schriften die geplante deflationäre Depression zu verhindern versucht, mit der dann von 1929-33 die Senkung der Löhne und Preise und des Lebensstandards der Arbeiter auf das Vorkriegsniveau von 1913 durchgesetzt werden sollte. Keynes konnte nicht einfach totgeschwiegen werden und man musste nach dem geistigen Bankrott der Neoklassik in der Weltwirtschaftskrise die alten Thesen erst einmal als keynesianische Theorie maskieren, um sie dem Publikum weiterhin eintrichtern zu können. So entstand der von Joan Robinson so genannte Bastardkeynesianismus, die Verfälschung der Lehren von Keynes.
Den sich mit verschiedensten Tricks auf Keynes berufenden Bastardkeynesianer erkennt man zuverlässig daran, dass ihm das Gleichgewicht der Ökonomie das wichtigste Thema ist, dem echten Keynesianer dagegen die optimale Auslastung des Produktionspotentials und die Vollbeschäftigung. Für den echten Keynesianer streben die Marktkräfte immer stärker von jedem optimalen Grad der Auslastung weg, während der Bastardkeynesianer die Teilmärkte von selbst einem optimalen Gleichgewicht zustreben sieht, was nur von Gewerkschaften (rigide Löhne) und Regierung (externe Schocks) behindert oder gar verhindert wird.
Die bastardkeynesianischen Modelle berufen sich auf Keynes, weil sie angeblich rigide Löhne und unvorhersehbare externe Schocks in ihrem Modell berücksichtigen und die Sparquote meist noch vom Einkommen und nicht wie früher vom Zins abhängt. Von dergleichen hat Keynes zwar irgendwo einmal geschrieben, aber das ist alles nicht der wesentliche Punkt seiner Theorie. Bei Keynes ist es die Notenbankpolitik, die eine deflationäre Depression auslösen und beenden kann, was er allerdings nach der Großen Depression aus menschlich verständlichen Gründen bei seiner General Theory weggelassen hat; die Verheerungen durch die Krise waren schon geschehen und nicht mehr zu verhindern und er wollte die Verantwortlichen und ihre Kreise, mit denen er ja täglich Umgang hatte, wohl nicht der Rache der Straße ausliefern.
Dieser weiche Charakter von Keynes wurde sofort von interessierter Seite ausgenutzt, um aus seiner Lehre beginnend mit dem IS/LM-Modell von Hicks und Samuelson eine Karikatur der echten keynesianischen Überzeugungen zu fabrizieren. An den Universitäten wird bis heute generell nur Bastardkeynesianismus gelehrt, was für die interessierten Kreise noch den Vorteil hat, dass die Studenten sich über die keynesianischen Vorstellungen für voll informiert halten und von Keynes schon gar nichts mehr hören und lesen wollen. Seine Essays in Persuasion aus den 1920er Jahren, in denen die wirklichen Hintergründe der Krise zur Sprache kommen, bleiben daher weitgehend unbekannt:
Here are collected the croakings of twelve years—the croakings of a Cassandra who could never influence the course of events in time. The volume might have been entitled "Essays in Prophecy and Persuasion," for the Prophecy, unfortunately, has been more successful than the Persuasion. But it was in a spirit of persuasion that most of these essays were written, in an attempt to influence opinion. ...
John M. Keynes, Essays in Persuasion (ebook, guttenberg.ca), Preface, Macmillan 1931
Dass England und die Staaten des Sterling-Blocks schon 1931 den Goldstandard verlassen haben, war vermutlich diesen Schriften von Keynes zu verdanken.
Wie der Bastardkeynesianismus Keynes erfolgreich in Verruf gebracht hat
Paul Davidson, der Herausgeber des Journal of Post Keynesian Economics, wunderte sich, wie die von Keynes ausgelöste Revolution der Ökonomie, trotz ihrer Nachkriegserfolge mit hohen Wachstumsraten, Vollbeschäftigung und steigendem Massenwohlstand, derart in Misskredit geraten konnte, dass die Neoliberalen und Neoklassiker nun seit über dreißig Jahren trotz der von ihnen verursachten Wirtschaftskrisen und Massenarbeitslosigkeit die Politik bestimmen:
How can we explain the death blow given to this revolutionary analysis developed by the greatest thinker in economics in the 20th century?
Paul Davidson, Keynes´ Seroius Monetary Theory, S. 2 (PDF)
Da spielt nicht nur das Geld eine Rolle, mit dem Ökonomieprofessoren, Journalisten und Politiker von den Profiteuren dieser Politik gekauft werden. Wir müssen auch den an den Universitäten völlig ausbleibenden Widerstand der Studenten gegen die herrschende Lehre erklären.
Die Erklärung ist die Tarnung der herrschenden Lehre als Keynesianismus!
Die Studenten werden von ihren Professoren erfolgreich in dem Glauben gehalten, dass das an den Universitöäten gelehrte "keynesianische Modell" tatsächlich die Lehren und Erkenntnisse von Keynes enthalte. Der völlig groteske Blödsinn des IS-LM-Modells der Neoklassischen Synthese, dass also die Investitionen vom nominalen Geldmarktzins bestimmt würden und der Zins von einer Geldmenge usw. usf., wird den Studenten als Lehre von John Maynard Keynes dargelegt. Je stärker die Studenten zumindest unbewusst den Blödsinn durchschauen und je dümmer der dieses "keynesianische Modell" lehrende Professor, desto erfolgreicher wird das heimliche Ziel erreicht, dass die Studenten ebenso unbewusst eine gewaltige Wut auf John Maynard Keynes entwickeln und dessen Werk im Original auf gar keinen Fall mehr studieren werden:
A sage once said that the definition of a “classic” is a book that every one cites but no reads. Mainstream economists who call themselves “Keynesians”, and yet attribute unemployment to wage, price rigidities or an interest rate liquidity trap, must think of Keynes’s General Theory as a literary classic that they can cite without bothering to read or understand Keynes’s serious monetary theory.
Davidson, a.a.O. S. 3
Die neoklassische Synthese von John Hicks und Paul Samuelson
Nach den Erfahrungen mit der Weltwirtschaftskrise war das Ansehen der Neoklassik ruiniert und die VWL-Professoren brauchten ein neues Modell: Geld durfte nicht mehr einfach als neutral gelten, aber es sollte sich am Prinzip des Allgemeinen Gleichgewichts der Märkte gar nichts ändern; vor allem musste es dem Publikum als keynesianisches Modell verkauft werden.
Die Allgemeine Theorie von Keynes, in deren Titel ausdrücklich der Zusammenhang zwischen Beschäftigung, Zins und Geld festgestellt wurde, erschien im Februar 1936 und erregte großes Aufsehen. Bereits im September 1936 diskutierten Ökonomen auf einer Konferenz in Oxford die Integration seiner Thesen in ein mathematisches Modell nach neoklassischen Vorstellungen.
John Hicks präsentierte im April 1937 sein IS-LM-Modell unter dem Titel „Mr. Keynes and the Classics - A Suggested Interpretation“, mit dem die Verfälschung der Lehre von Keynes vollzogen wurde, die sogenannte Neoklassische Synthese. Der 1937 nach Harvard berufene Alvin Hansen trug ebenfalls zum IS/LM-Modell bei und es wurde als Hicks-Hansen Synthese in den USA gelehrt. Paul Samuelson publizierte 1948 in seinem Bestseller-Lehrbuch diese angebliche Ökonomie nach Keynes. Er wurde mit dem Schwindel weltberühmt und als erster US-Amerikaner mit dem sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis ausgezeichnet.
Das an den Universitäten gelehrte keynesianische Modell der neoklassischen Synthese ist die Fälschung von Hicks und Samuelson, die von Keynes nur übernahmen, dass von hohen Einkommen ein größerer Anteil gespart werde und dass bei sehr niedrigen Zinsen für die langfristigen Bonds eine Bargeldhortung erfolgt. Beide Punkte sind völlig trivial und haben mit dem Kern der konjunkturpolitischen Einsichten von Keynes nichts zu tun. Leider war der Schwindel sehr erfolgreich und die meisten Studenten meinen tatsächlich zeitlebens ernsthaft, sie hätten die Lehren und Erkenntnisse von Keynes an der Uni studiert.
Das IS/LM-Modell ist bereits mit der Annahme hinfällig, dass es mit wachsenden Einkommen eine steigende "Sparkurve" geben werde. Keynes ist von einer mit dem Einkommen wachsenden Sparneigung der oberen Einkommensklasse ausgegangen, die dann ganz langfristig bei weiter wachsendem Wohlstand in der breiten Gesellschaft einen bis auf Null fallenden Zins zur Folge haben müsse. Denn die tatsächliche Sparmöglichkeit ist ja auf das Wachsen des realen Kapitalstocks beschränkt. Abgesehen von den Schwankungen der Konjunktur haben wir historisch bis jetzt keinen Nachweis einer für die gesamte Ökonomie und nicht nur für die obere Einkommensschicht der Gesellschaft steigenden Sparquote. Bereits 1942 hat Simon Kuznets für den Zeitraum von 1870 - 1940 eine langfristig konstante Sparquote der Ökonomie diskutiert, was dem IS/LM-Schwindel aber nicht schaden konnte.
Das Problem mit der steigenden Ersparnis bei höheren Einkommen wäre sinnvoll als Wachstumshemmnis der Ökonomien zu diskutieren: Es gibt also keinen Kapitalmangel, so dass eine steigende Investitionsquote mit einer steigenden Ersparnis zu einem Gleichgewicht bei einem höheren Y der Ökonomie finden könnte; die hohe Sparneigung der oberen Einkommensklasse führt bei einer sehr ungleichen Verteilung der Einkommen zu Gunsten dieser oberen Einkommensklasse schlicht zur Verarmung der Ökonomie, weil das Produktionspotential nur durch entsprechend hohe Verschuldung ausgelastet werden könnte. Dabei kommt es sehr auf die Verteilung der Einkommen an und nicht auf das Y (Gesamteinkommen) der Ökonomie, so dass also die Einkommensverteilung in der Ökonomie der zu diskutierende Wachstumsfaktor wäre.
Weitgehend unbekannt ist heute, dass bereits 1947, ein Jahr vor dem Buch von Samuelson, der begeisterte Keynesianer Lorie Tarshis sein Werk The Elements of Economics (archive org) in den USA publizieren konnte. Nach einem kurzen Anfangserfolg wurde das Buch zur Zielscheibe einer Kampagne libertärer und reaktionärer Kreise gegen die Schulen und Universitäten, die es als Lehrbuch eingeführt hatten. David Colander hat die Details der Auseinandersetzung (PDF) beschrieben. Tarshis war 1936 in Cambridge ein Student von Keynes und kam anschließend in die USA, wo er schon 1938 gemeinsam mit jungen Ökonomen von Harvard die Ideen von Keynes mit einer kleinen Schrift zu popularisieren half. Seine Aussage zu Samuelson:
Paul Samuelson was not in the Keynesian group. He was busy working on his own thing. That he became a Keynesian was laughable.
David Colander and Harry Landreth: The Coming of Keynesianism to America, Brookfield, Vt.: Edward Elgar, 1996 S. 64
Die Zinspolitik der FED und die Finanzkrise

Dieser Einschub soll Ihnen helfen, den VWL-Unsinn mit dem IS/LM-Modell besser zu durchschauen. Die Grafik rechts zeigt die Zinspolitik der FED in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren ab Februar 2000. Im Sommer 2000 hatte die Fed ihren Leitzins noch bis auf 6,5 Prozent hochgetrieben und damit den Börsencrash vor allem des sogenannten Neuen Marktes ausgelöst und die Weltwirtschaft in eine schwere Rezession getrieben, die bis ins Jahr 2003 ging.
Die Kurve zeigt einfach das Ergebnis der geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank, wie hoch der für Zentralbankgeld geforderte Zins sein soll. Der Zins wird nicht vom Markt bestimmt, sondern von den Leuten, die über die Geldpolitik die Konjunktur steuern. In den frühen 80er Jahren gebrauchte die Bundesbank zur Verwirrung des Publikums neben einem Diskontsatz und dem Lombardsatz noch Zinstender und Mengentender, um dem Publikum vorzugaukeln, dass der Markt den Zins bestimme. Das ist jedoch nicht der Fall, aber das Publikum war schon mit den wichtigen Debatten über den Unterschied zwischen Diskont und Lombard geistig ausreichend beschäftigt, um gar nicht zu bemerken, dass die Bundesbank einfach mit Hochzinspolitik Krise und Massenarbeitslosigkeit verursacht hatte.
Nach der Auslösung der schweren Rezession ab 2000 wurden die Zinsen bei der FED sehr weit bis auf 1% gesenkt. Die Notenbanker wollen zwar eine Rezession auslösen, aber nicht, dass ihnen der Laden gleich ganz um die Ohren fliegt. Für das Publikum ist das dann oft noch ein Rätsel, dass auf dem Höhepunkt der Krise die Zinsen meist schon wieder ganz unten sind, was die Neoliberalen dazu benutzen, den Leuten einzureden, dass die Niedrigzinspolitik für die Krise verantwortlich wäre.
Die Auslösung der Finanzkrise ist in dieser Grafik sehr schön zu sehen. Die FED hatte ab 2004 damit begonnen, die Zinsen wieder scharf hochzutreiben, bis so etwa im Sommer 2007 für die Insider der Einbruch der Konjunktur abzusehen war. Das hat allerdings die Europäische Zentralbank nicht gehindert, ihre Zinsen sogar noch im Sommer 2008 noch einmal zu erhöhen, um irgendwelche Inflationsgefahren zu bekämpfen, also die Wirtschaft mit Hochzinspolitik abzuwürgen. Nach der Auslösung der Finanzbetrugskrise, die dem Publikum immer als völlig unvorhersehbar dargestellt wurde, haben FED und EZB die Zinsen dann wieder stark gesenkt, die FED bis auf fast 0%.
Abschließend zeigt ein Blick auf die Grafik sehr schön, wie die Zinspolitik der Notenbank stets gegen die Marktkräfte entweder mit sehr niedrigen Zinsen die Konjunktur belebt oder mit Hochzinspolitik die Krisen auslöst. Dies soll eine Grundlage für die nachfolgende Diskussion des IS/LM-Modells sein, in dem die Zusammenhänge völlig auf den Kopf gestellt werden. In diesem Modell wird der Zins nämlich nicht von der Geldpolitik gemacht, sondern es gäbe einen Gleichgewichtszins für Ersparnis und Investition und für das Angebot und die Nachfrage nach Geld, zu dem die Marktkräfte angeblich von selber streben würden.
Die IS-Kurve über der Y-Achse verläuft im Nirgendwo

Das Gleichgewicht wird so definiert, dass die geplante Ersparnis mit der geplanten Investition übereinstimmt. Es kann also sein, dass die Investition zu einer höheren oder geringeren als der geplanten Ersparnis geführt hat oder dass die Güternachfrage einen ungeplanten Aufbau oder Abbau von Lagerbestand und damit ungewollte Investition oder Desinvestition zur Folge hatte. Die immer identischen Investitionen und Ersparnisse in einem Zeitraum können ungeplante und ungewünschte Bestandteile enthalten, so dass der Gütermarkt nicht im Gleichgewicht ist, weil die Investoren und Sparer ihre Dispositionen anschließend entsprechend ändern werden. Die IS-Kurve soll Kombinationen von Zinsen und Einkommen darstellen, bei denen die geplante Ersparnis und Investition im Gleichgewicht wären. Ob der Gütermarkt tatsächlich in einem Gleichgewicht ist und die geplante Investition mit der freiwilligen Ersparnis genau übereinstimmt, lässt sich niemals objektiv feststellen. Man kann nur mit Annahmen über die Zinsabhängigkeit der geplanten Investition und die Einkommensabhängigkeit der freiwilligen Ersparnis behaupten, dass bei einer bestimmten Kombination von Zins und Einkommen ein Gleichgewicht des Gütermarkts vorliegen würde.
Aber erstens ist für echte Keynesianer die Suche nach dem Gleichgewicht von makroökonomischen Märkten sinnlos, weil die Märkte grundsätzlich kein Gleichgewicht finden. Es gibt keinen Zinssatz, bei dem die Märkte im Gleichgewicht wären. Die Geldpolitik muss immer wieder mit Zinsänderungen der Tendenz der Märkte entgegen wirken, ihre Abweichungen von einer optimalen Auslastung des Produktionspotentials zu verstärken. Die Zinsen müssen also stark schwanken, wie oben am Leitzins der FED von 2000 bis 2009 deutlich zu erkennen, um einmal die Konjunktur zu dämpfen und sie danach wieder zu beleben.
Zweitens ist die Diskussion eines Gleichgewichts von Investition und Ersparnis bei Unterauslastung des Produktionspotentials völlig gegenstandslos. Nur bei einer maximalen Auslastung der Ökonomie müsste für jede Investition am Konsum gespart werden, was die Geldpolitik mit den Zinsen bewirkt. Da nützt allerdings keine Gleichgewichtskurve über einer Y-Achse, sondern die Notenbank muss wissen, wie der Auslastungsgrad der Ökonomie ist und ob sie mit niedrigeren Zinsen die Nachfrage beleben soll oder mit höheren Zinsen dämpfen. Die IS-Kurve stellt diese Zusammenhänge auf den Kopf und genau das ist ihr Zweck.
Drittens wäre der Realzins und nicht der Nominalzins zu diskutieren. Denn der kurzfristige und der langfristige Realzins sind für die Investitionsentscheidung maßgeblich. Dabei entscheidet der langfristige Realzins, ob die Investition überhaupt getätigt wird, ihre Rendite muss also über dem langfristigen Realzins liegen. Weil der Realzins von der Entwicklung der Preise abhängt, kann er auf Betreiben der Geldpolitik sogar negativ werden und es reicht eine entsprechend glaubwürdige Absichtserklärung der Notenbank, um auch auf dem Tiefpunkt der schlimmsten Depression sofort eine Welle von Investitionen auszulösen. Der kurzfristige Realzins entscheidet, ob die Investition sofort begonnen oder wegen der Erwartung weiter fallender Löhne und Preise noch um Jahre aufgeschoben wird. Im IS-LM-Modell ist nur vom kurzfristigen, nominalen Geldmarktzins die Rede, es handelt sich also schon darum um Unsinn.
Der IS-Kurve liegen zwei Annahmen zugrunde: Einmal die Abhängigkeit der Investitionen vom Zins, und zwar nur vom Zins. Die Investitionskurve (Quadrant II) bildet hohe Zinsen mit niedrigen und niedrige Zinsen mit hohen Investitionen ab, wobei das Volumen der Investition nicht von Y abhängen darf, was bei starken Änderungen von Y völlig unrealistisch wird. Zweitens soll nach Keynes die geplante Ersparnis mit den Einkommen steigen (Quadrant IV), wir bräuchten also bei einer halbierten Investition und Ersparnis womöglich ein um ein Drittel geschrumpftes Einkommen, damit sich auch die daraus geplante Ersparnis halbiert. Trotz Formelwust sollte den Studenten auffallen, wie absurd die mit der IS-Kurve verbundene Vorstellung ist, dass bei unzureichender Investition eine entsprechend gewaltig einbrechende Produktion noch zu irgendeinem „Gleichgewicht“ links vom aktuellen Y(t) führen sollte.
Wie soll das Gleichgewicht bei einem gewaltigen Einbruch der Einkommen überhaupt erreicht werden? Wir haben ja noch die Produktionsfunktion mit Y = f(N,K) und müssten auf dem Anpassungsweg ins neue Gleichgewicht bei einem viel tieferen Y irgendwie Kapital und Arbeit verlieren. Führen unzureichende Investitionen zu einem Anstieg der Reallohnforderungen bei einbrechendem BIP, damit die Zahl der Arbeiter sinkt? Damit dieses geschrumpfte Einkommen aber irgendwann in einem "Gleichgewicht", also bei Vollbeschäftigung und optimaler Auslastung des Produktionspotentials produziert wird, müsste die deflationäre Depression erst einmal einen großen Teil des Kapitals und der Arbeiterschaft vernichtet haben. Bei überhöhten Zinsen hätten wir auch mit einem niedrigeren Gesamteinkommen immer noch eine überhöhte Sparneigung bei unzureichender, weil ja auch von Y, also von erwarteten Erträgen, abhängiger Investition. Die Zinsen müssten gesenkt werden, um auf dem niedrigen Niveau nach der verheerenden Krise im "Gleichgewicht" zu produzieren. Die IS-Kurve ist also auch diesbezüglich falsch, wenn sie ein Gleichgewicht bei höheren Zinsen und niedrigeren Einkommen vorgaukelt.
Natürlich kann eine Ökonomie schrumpfen und nach einiger Zeit der Kapitalvernichtung und des Verhungerns des Bevölkerung wieder in ein Gleichgewicht bei niedrigerer Produktion finden. Das müsste man den Studenten dann aber auch so erklären, und nicht so tun, als ob es sich hier um einen kurzfristigen Anpassungspfad an ein neues Gleichgewicht mit höheren Zinsen handle. Die Verdopplung der Investition durch sehr niedrige Zinsen müsste entsprechend einen gewaltigen Anstieg des volkswirtschaftlichen Einkommens erfordern. Wollte man dies mit eben jenen zu niedrigen Zinsen erreichen, würde die Ökonomie schnellsten in Hyperinflation kollabieren. Also auch rechts von Y(t) finden wir kein Gleichgewicht mit niedrigeren Zinsen nach einem plötzlich phantastischen Anstieg des BIP. Wenn die Investition mit dem schrumpfenden Einkommen schrumpfen wird und umgekehrt bei einem gewaltig ansteigenden Einkommen noch weiter ansteigt, ist klar, wo allein die IS-Kurve verlaufen kann, nämlich im Nirwana.
Die Abhängigkeit der geplanten Ersparnis vom Einkommen setzt ja entsprechend große Änderungen dieses Einkommens voraus, um diese mit den leicht durch höhere oder niedrigere Zinsen stark einbrechenden oder sich vervielfachenden Investitionen in Einklang zu bringen. Da müsste die Volkswirtschaft der USA für ein neues Gleichgewicht zum Beispiel von einem GDP von $15.000 Mrd. auf nur noch $10.000 Mrd. schrumpfen oder gleich auf $25.000 Mrd. hochspringen, damit sich die freiwillige Ersparnis an die Investitionen anpasst, die aber auf diese Veränderungen des GDP nicht auch noch prozyklisch reagieren dürften, wenn es je zu einem Gleichgewicht der geplanten Ersparnisse mit den Investitionen kommen soll. Diese Änderungen des Gesamteinkommens der Ökonomie würden selbstverständlich prozyklisch die Investitionen zusätzlich in den Keller oder in Richtung Mond jagen, ohne jemals zu einem Gleichgewicht der geplanten Investition und Ersparnis zu führen. Die Professoren wissen schon, warum sie es immer mit besonders verdrehten mathematischen Formeln treiben, denn die Darstellung und Verteidigung der IS-Kurve mit klaren Worten würde ihnen einen Hörsaal schenkelklopfender und vor Vergnügen kreischender Studenten bescheren, die sich bedeutungsvoll an die Köpfe fassen und in Richtung ihres Professors Grimassen schneiden. Aber der Irrsinn der IS-Kurve bleibt hinter dem Schleier aus mathematischem Formelwust gut verborgen.
Eigentlich hatte Keynes geschrieben, dass die mit der Investition identische Ersparnis um den Multiplikator verstärkt das Einkommen der Ökonomie beeinflusst. Eine durch höhere Zinsen sinkende Investition erzwingt also entsprechend dem sich aus der Sparquote ergebenden Multiplikator einen heftigen Einbruch der Einkommen, wie wir ihn in der Großen Depression erlebt haben. Denn die ökonomische Saldenmechanik setzt die sinkende Ersparnis mit wegbrechenden Einkommen durch. Dass es dann bei einem um ein Drittel geschrumpften GDP ein neues Gleichgewicht geben würde, haben Keynes oder Stützel nirgendwo behauptet. Aber die Professoren haben die Erklärung der Krise durch Keynes mit dem IS-LM-Modell völlig verdreht und in eine Gleichgewichtslehre verwandelt.
Kurz noch einen Blick auf den Blödsinn oben rechts: Wir sehen in der Abbildung zwei rot gestrichelte Rechtecke. Das mehr links liegende Rechteck ergibt sich bei einem höheren Zinssatz und dadurch niedrigeren Investitionen. Dem entsprechen niedrigere Ersparnisse, die sich bei einem geringeren Einkommen Y einer ärmeren Ökonomie ergeben. Eine verstärkte Neigung zum Sparen würde die Gerade im Quadrant 4 steiler ansteigen lassen und ein „im Gleichgewicht“ niedrigeres Y bewirken, das Paradoxon des Sparens lässt sich also an der IS-Kurve demonstrieren.
Nur die Schlussfolgerungen aus dem Modell hätten noch etwas mit Keynes zu tun: Eigentlich wäre alles bestens, wenn die Zinsen möglichst niedrig sind und die Sparneigung möglichst gering. Dann wären die Investitionen hoch und wir würden zum Ausgleich bei einer sehr flachen Sparkurve ein maximal großes Einkommen Y der Ökonomie erhalten. Besser könnten wir für eine keynesianische Politik niedriger Zinsen bei geringer Sparneigung gar nicht werben, aber das war von Hicks und Samuelson selbstverständlich so nicht beabsichtigt. Die wollten nur das Gleichgewicht zeigen, zu dem die Märkte angeblich von selber streben.
Die LM-Kurve mit künstlich beschränktem Geldangebot

Ehe Sie sich lang und breit den Kopf zerbrechen - wir haben es hier mit mehrfachem Unsinn zu tun: Erstens ist der für Investition und Ersparnis relevante Zins der langfristige Realzins, während die LM-Funktion für Angebot und Nachfrage auf einem Geldmarkt nur den kurzfristigen Nominalzins liefern würde, der sich später auch nicht im Gleichgewicht mit einer IS-Kurve schneiden sollte. Zweitens existiert ein Geldmarkt, auf dem sich für die Nachfrage nach Zentralbankgeld ein Gleichgewichtszins einstellen würde, höchstens als Kopftheater von VWL-Professoren, weil die Zentralbank einfach für ihr Zentralbankgeld den Zins festlegt. Drittens gibt es bei fiat money keinen Grund für eine beschränkte Geldmenge und somit auch keinen steigenden Zins bei wachsendem Sozialprodukt als Ergebnis von Marktprozessen, sondern steigende Zinsen sind die Folge gezielter Notenbankpolitik, um die Konjunktur abzuwürgen. Viertens ist die dargestellte Kurve, wie sie von der VWL präsentiert wird, nur teilweise die Kurve für den kurzfristigen Geldmarktzins, denn der kurzfristige Nominalzins für Zentralbankgeld kann von der Notenbank sogar unter Null festgelegt werden; in der VWL-Kurve soll der Zins aber nicht auf Null sinken, was mit Keynes begründet wird, der diesen Effekt aber nur für den langfristigen Anleihenzins beschrieben hat. Im sogenannten keynesianischen Bereich müsste die Kurve, wenn sie denn einen Sinn haben sollte, den langfristigen Nominalzins abbilden, denn nur der sinkt nicht auf Null. Und glauben Sie ja nicht, Ihnen würde der Nobelpreis für Wirtschaft verliehen, wenn sie all diesen Unsinn in einer wissenschaftlichen Arbeit nachweisen; das ist ein Charaktertest für die Studenten, ob sie auch den geballtesten Blödsinn der VWL zu akzeptieren bereit sind oder dabei versagen. Und nein, die Professoren, die solche Modelle lehren, sollten nicht vom Amtsarzt auf ihren Geisteszustand und weitere Berufstauglichkeit untersucht werden; die wissen um den Blödsinn und er soll dazu dienen, noch dem letzten VWL-Studenten das logische Denken auszutreiben.
Das wirklich Perfide an diesem von Hicks, Hansen und Samuelson fabrizierten und verbreiteten Humbug einer Neoklassischen Synthese ist dann, dass die Professoren mit böser Absicht ihre Studenten in dem Glauben halten und ständig bestärken, dieser unerträgliche Schwachsinn sei tatsächlich die Lehre von - John Maynard Keynes!
Nun aber zurück zum Modellbau: Die LM-Kurve (im Quadranten oben rechts) soll das Gleichgewicht auf dem Geldmarkt für alle Kombinationen von Zins und Einkommen abbilden. Die Kurve steigt nur unter der Voraussetzung, dass das Geldangebot beschränkt ist. Dafür gibt es aber bei fiat money keinerlei Gründe. Nur wenn die Notenbank ihr „Geldangebot“ (worunter man die sogenannte „Geldmenge“ zu verstehen hat – wir wissen aber, dass die Notenbank eine Zinspolitik macht und eben keine „Geldmenge“ steuert) künstlich beschränken würde, müsste es bei einem weiter steigenden Wachstum des Y zu wegen der „Geldknappheit“ steigenden Zinssätzen kommen.
Unter dem Goldstandard war die Geldmenge durch den Goldvorrat und die Deckungsvorschriften der Banknoten beschränkt, aber der internationale Goldstandard endete 1933 mit dem Verbot der Goldhortung in den USA. Seitdem ist das umlaufende Geld fiat money und jede Beschränkung seiner „Menge“ wäre ein willkürlicher Akt der Notenbank.
Ohne diese nur willkürlich theoretische Beschränkung des Geldangebots schneidet die LM-Kurve im IS-LM-Modell die IS-Kurve überall, wo man einen Schnittpunkt haben will. Die Notenbank kann praktisch zu jedem Zeitpunkt eine expansivere Geldpolitik betreiben und damit die LM-Kurve für das Gleichgewicht am Geldmarkt (Geldangebot = Geldnachfrage) nach rechts verschieben.
Umgekehrt kann die Notenbank mit einer restriktiven Geldpolitik das Geldangebot künstlich knapp halten, so dass bei Wirtschaftswachstum steigende Zinsen resultieren würden, wie es die LM-Kurve darstellt; aber das ist kein ökonomisches Gesetz, sondern eben Geldpolitik. Es wird übrigens bei der LM-Kurve allein das umlaufende Zentralbankgeld diskutiert, also Scheine und Münzen, aber kein durch Kreditvergabe der Geschäftsbanken geschöpftes Buchgeld. Dabei wäre der Bargeldumlauf völlig verzichtbar für die ökonomische Diskussion, die LM-Kurve gegenstandslos, die Zentralbank macht ja Zinspolitik und steuert keine Geldmenge aus Scheinen und Münzen.
Damit ist das Modell von Hicks absolut unbrauchbar und wir könnten uns seine weitere Diskussion sparen, weil der Verlauf der LM-Kurve nicht aus ökonomischen Zusammenhängen resultiert, sondern höchstens aus einer willkürlichen Geldpolitik der Notenbank. Diese LM-Kurve dann für ein Gleichgewicht der Märkte zu diskutieren, ist völlig abwegig: Mit einem von der Zentralbank bestimmten Zins gibt es keine zu einem Gleichgewicht strebenden Märkte, sondern einen von der Geldpolitik gesteuerten Gütermarkt. Das Modell ist also völliger Unsinn.
Wir müssen hier aber leider beim Modell bleiben. Der Quadrant oben rechts zeigt den Verlauf der LM-Kurve. Ein wachsendes Y bräuchte nach der Geldmengenformel bei konstanter Umlaufgeschwindigkeit immer mehr Liquidität zu Transaktionszwecken. Das Geldangebot ist aber künstlich von der Notenbank beschränkt, so dass bei steigender Produktion das knappe Geld für zuletzt steil steigende Zinsen sorgt. Diese steil steigenden Zinsen beschränken schließlich im IS-LM-Modell das Wachstum von Produktion und Einkommen.
Die Lösung des gekünstelten Problems wäre einfach mehr Geldversorgung durch die Notenbank, dann könnte Y stärker nach rechts verschoben werden, also die Produktion und die Einkommen könnten stärker steigen.
Zur Liquiditätsfalle
Ich will aber noch kurz auf die Geldnachfrage eingehen, mit der angeblich die geistigen Anstöße von Keynes umgesetzt und im Modell berücksichtigt worden seien.
Im Quadranten oben links sieht man die Zinskurve mit steigendem Geldangebot (Liquidity Supply) fallen (relativ zu Y; eigentlich geht die Darstellung von einem fixen Geldangebot bei variablem Y aus, aber lassen Sie sich von diesem Quadranten-Schema nicht verwirren), zuletzt geht sie in eine Waagrechte über. Dies deshalb, weil eine weitere Zinssenkung auch bei einer noch größeren Ausweitung der Geldmenge nach Keynes wegen des Kursrisikos der Geldanlagen nicht möglich ist. Steigende Zinsen führen ja zu sinkenden Kursen der Bonds, weshalb bei langfristigen Papieren ein Mindestzins zu erwarten ist, den auch eine noch so expansive Geldpolitik nicht weiter senken kann. Allerdings können nur langfristige Zinsen wegen des Kursrisikos nicht auf Null fallen, die kurzfristigen Zinsen können das sehr wohl und die Zinsen für Zentralbankgeld können sogar negativ werden. Die in der VWL benutzte LM-Kurve stellt ja den kurzfristigen Zins dar und müsste deshalb sehr wohl auf Null fallen. Sogar ohne ein "unendlich großes Geldangebot", das ja hier eine völlig falsche Vorstellung ist, weil die Notenbank den kurzfristigen Zins nicht durch ein Geldangebot auf Null treibt, sondern einfach den Zins für Zentralbankgeld auf Null oder sogar unter Null festsetzt. Die in der VWL übliche Darstellung der LM-Kurve ist also sachlich falsch.
In Wirklichkeit macht die Notenbank selbstverständlich überhaupt keine Geldmengenpolitik, sondern sie bestimmt den Zinssatz für das Zentralbankgeld (auch damit kann die Notenbank den Zins für langlaufende Bonds nicht unter den Risikozins drücken). Das Bankensystem wird von der Notenbank mit allem benötigten Zentralbankgeld versorgt, nur eben zu entsprechend niedrigen oder hohen Zinsen. Diese Realität ist im IS-LM-Modell völlig auf den Kopf gestellt.
Es wird auch ein weiterer Punkt übersehen: Zinssätze nahe Null gibt es nur nominal in Deflationsphasen, es handelt sich also nicht um die Realzinsen. In der Großen Depression ergaben sich bei Nominalzinsen von 2%-3% Realzinsen wegen der Deflation der Preise von 10% - 20% und für Investitionen ist der Realzins entscheidend, da spielt also die Liquiditätsfalle, die Keynes etwas zu sehr betont hat, gar keine Rolle, sondern der Umstand, dass der Nominalzins halt kaum unter Null gehen kann. Bei Berücksichtigung der Realzinsen haben wir in der Liquiditätsfalle also meist eine heftige Hochzinspolitik, die das Publikum nicht sieht, weil es nur den Nominalzins kennt.
Wie John Hicks sich von seinem IS-LM-Modell distanzierte

John Hicks, der Erfinder des IS-LM-Modells, hat sich später deutlich davon distanziert, was den Studenten meist vorenthalten wird, daher will ich es hier zitieren:
The IS-LM diagram, which is widely, but not universally, accepted as a convenient synopsis of Kesnesian theory, is a thing for which I cannot deny that I have some responsibility. ... I have, however, not concealed that, as time has gone on, I have myself become dissatified with it. ... In the reconstruction of Keynesian theory which I published at abaout the same time (1974), it is not to be found.
John Hicks, "IS-LM": An Explanation Source (PDF) Journal of Post Keynesian Economics,
Vol. 3, No. 2 (Winter, 1980-1981), pp. 139-154, S. 139
John Hicks hat dann gleich auch noch eine passende Bezeichnung für sein IS-LM-Modell gefunden:
I accordingly conclude that the only way in which IS-LM analysis usefully survives - as anything more than a classroom gadget, to be superseded, later on, by something better - is in application to a particular kind of causal analysis, where the use of equilibrium methods, eben a drastic use of equilibrium methods, is not inappropriate.
John Hicks, "IS-LM": An Explanation Source: Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1980-1981), pp. 139-154, S. 152
Die Professoren lehren also "a classroom gadget", um ihren Studenten die gewünschten Vorstellungen in die Köpfe einzupflanzen. Zu diesen Vorstellungen gehört, dass sich trotz zu hoher oder zu niedriger Zinsen kurzfristig ein neues Gleichgewicht ergäbe. Dabei wären die Zinsen nicht böswillig von der Notenbank angehoben, sondern ein Gleichgewichtszins am Geldmarkt, wo die Notenbank doch nur eine Geldmenge steuert, um Inflation zu vermeiden. Jedenfalls würden wir mit überhöhten Zinsen z.B. bei einem halbiertem BIP oder mit zu niedrigen Zinsen bei einem verdoppelten BIP wieder ein allgemeines Gleichgewicht von Investition und Ersparnis und Geldangebot und Geldnachfrage erhalten. In Wirklichkeit wäre die Ökonomie bei halbiertem Einkommen in einer deflationären Depression, der Versuch einer kurzfristigen Verdopplung der Einkommen würde die Hyperinflation starten. Aber das Modell ist nur "a classroom gadget" für die Studenten, die Professoren sind ja nicht blöde, sondern halten damit nur ihre Studenten dumm.
John Hicks hat auch schon von Anfang an betont, dass die Notenbank in der LM-Funktion den Zins festsetzt, weil sie allein das Zentralbankgeld anbietet:
For I may allow myself to point out that it was already observed in "Mr. Keynes and the Classics" that we do not need to suppose that the curve is drawn up on the assumption of a given stock of money. It is sufficient to suppose that there is (as I said)
a given monetary system - that up to a point, but only up to a point, monetary authorities will prefer to create new money rather than allow interest rates to rise. Such generalised (LM)
curve will then slope upwards only gradually - the elasticity of the curve depending on the elasticity of the monetary system (in the ordinary monetary sense).(p.157)(in the reprint of this paper
in my Critical Essays (1967), the passage appears on p. 140.)
John Hicks, "IS-LM": An Explanation Source: Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1980-1981), pp. 139-154, S. 150
Das angebliche Gleichgewicht der Märkte entpuppt sich als ein Kindergartenmodell für die Studenten. Während in Wirklichkeit die Notenbank den Zins bestimmt, wird mit der LM-Kurve so getan, als habe sich ein Marktgleichgewicht von Geldangebot und Geldnachfrage zum Gleichgewichtszins eingependelt. Diese in Wahrheit in ihrer Elastizität allein von der Geldpolitik abhängige LM-Kurve lässt man dann eine Kurve aus überhöhtem Zins und halbiertem BIP oder zu niedrigem Zins und längst vor der Verdopplung des BIP in eine Hyperinflation übergehende Ökonomie schneiden und erklärt Depression wie Hyperinflation zum Gleichgewicht von Investition und Ersparnis.
Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Grafik oben rechts: Hier sehen wir den Schnittpunkt der IS-Kurve mit der LM-Kurve im magischen Gesamtmarktgleichgewicht. Abgesehen davon, dass das IS/LM-Modell grundsätzlich Humbug ist, würde es sich durchaus dafür eignen, eine möglichst expansive Geldpolitik zu begründen und deren segensreiche Wirkungen zu zeigen.
Praktisch wird es aber nur dazu genutzt, die Studenten mit kompliziertesten Kurvenberechnungen von jedem klaren Gedanken abzubringen und ihnen zu demonstrieren, wie Märkte immer in ihr Gleichgewicht fänden, wenn sie nicht von der Politik mit externen Schocks gestört werden und die Erwerbslosen nicht zu faul wären.
Auf die Erörterung des erweiterten IS/LM-Modells mit Staatskonsum und Außenhandel soll hier verzichtet werden. Wer einen Blick darauf werfen will, wie weit sich das Modell mit variierenden Staatsausgaben und Außenhandel verkomplizieren lässt, kann ja im Internet nach typischen Prüfungsfragen zu diesem Thema suchen.
Die Studenten sind wirklich zu bedauern, weil das Modell die Zusammenhänge verdreht: Die Zinsen steigen nicht, weil die Geldmenge bei wachsender Produktion zu knapp wird, sondern die Notenbank stoppt mit Zinserhöhungen das Wachstum; im gutwilligen Fall, weil die Ökonomie zu weit im oberen Bereich der Auslastung des Produktionspotenzials ist, im böswilligen Fall, um die Löhne zu drücken, die Arbeiter wieder härter auszubeuten, die Rentiers zu bereichern, oder auch nur, weil einflussreiche Spekulanten an den Börsen gerade auf fallende Kurse gesetzt haben.
Der Arbeitsmarkt im bastardkeynesianischen Modell
Die neoklassische Synthese arbeitet mit dem neoklassischen Arbeitsmarkt und kann daher wieder nur „freiwillige“ Arbeitslosigkeit bei überhöhten Lohnforderungen diskutieren. In der Regel wird ein starrer Reallohn als Folge von Tarifverträgen und Gewerkschaftseinfluss beklagt. Das hat mit keynesianischen Vorstellungen gar nichts zu tun.
Echter Keynesianismus ist makroökonomisches Denken und kritisiert am Modell-Arbeitsmarkt der VWL, dass er eine mikroökonomische Betrachtung darstellt. Arbeit ist kein Produkt wie Erdbeermarmelade, die im Wettbewerb mit anderen Marmeladesorten steht und bei niedrigerem Preis dann mehr als die Kirschmarmelade gekauft wird. Wenn die Preise für Erdbeermarmelade sinken, geht das Angebot zurück, weil die Produzenten dann halt mehr Kirschmarmelade produzieren, aber die Arbeiter müssen bei sinkenden Löhnen ihr Arbeitsangebot sogar erhöhen, um ihr Leben zu fristen. Die mikroökonomische Betrachtung des Arbeitsmarktes ist also Unsinn.
Bei einer makroökonomischen Betrachtung wäre sofort klar, dass sinkende Nominallöhne gar nicht zu sinkenden Reallöhnen und einer steigenden Arbeitsnachfrage führen müssen, weil eine absehbare Deflation der Preise zum Beispiel Investitionen verhindert und sinkende Preise das Sinken der Nominallöhne aufheben können. Es sinken also nicht nur die Reallöhne nicht, sondern über das Sinken der Reallöhne kann in den Lohnverhandlungen überhaupt nicht entschieden werden. Die Erwartung weiter sinkender Löhne und Preise führt zu einem Rückgang der Arbeitsnachfrage, was nun genau das Gegenteil von dem ist, was die Professoren mit ihrem Modell zu beweisen vorgeben.
Das Modell setzt ganz naiv voraus, dass mehr Arbeit nachgefragt würde, wenn diese "billiger" wäre. Billiger als was? Manche Professoren meinen dann sogar, dass Arbeit gegenüber dem Einsatz von Kapital billiger werden könnte oder müsste, offensichtlich ohne zu bedenken, dass die Maschinen ja letztlich alle durch Arbeit entstanden sind. Billigere Arbeiter müssten dann auch billigere Maschinen bauen, sinkende Nominallöhne lassen die Preise der Maschinen sinken. Nur investiert dann niemand mehr und alle warten, dass die Löhne und Preise noch weiter fallen.
Umgekehrt führen steigende Löhne ganz bestimmt nicht dazu, dass die Kapitalisten dann lieber selber Hand anlegen, weil ihnen die Arbeiter zu teuer würden. Die Erwartung höherer Löhne führt wie bei allgemein steigenden Preise zu steigender und nicht zu sinkender Nachfrage nach Gütern wie nach Arbeitskräften. Wir sehen also, dass das mikroökonomische Ökonomen-X für den Arbeitsmarkt völlig unbrauchbar ist, weil auch der Arbeitsmarkt prozyklisch reagiert und damit sinkende Löhne zu einer sinkenden, steigende Löhne zu einer steigenden Nachfrage nach Arbeit führen müssen.
Zusätzlich wird im Modell das gleichgewichtige Y einmal mit dem Schnittpunkt der IS-LM-Kurven bestimmt, zweitens noch bei gegebenem Kapital als Y = f(N) durch die Arbeitsmenge N; also mit der Bereitschaft der Arbeiter, zu einem am Arbeitsmarkt bestimmten Reallohn zu arbeiten. Welcher magische Mechanismus die beiden Y immer im gemeinsamen Gleichgewicht vereinigen soll, konnte ich noch nicht klären. Vermutlich haben die VWL-Professoren den Widerspruch in ihrem Modell noch gar nicht realisiert.
Von Neokeynesianern zu Postkeynesianern nur Fälscher am Werk
Die Lehre von Hicks und Samuelson nannte sich Neokeynesianismus und wollte nur in Ausnahmen, vor allem wegen der angeblich nicht genug flexiblen Löhne, eine nicht freiwillige Arbeitslosigkeit zugestehen. Langfristig würde aber das Gleichgewicht durch die Marktkräfte wieder durchgesetzt.
Jede echte keynesianische Theorie würde darauf bestehen, dass die Märkte sich prozyklisch verhalten und Boom wie Krise verstärken; ohne eine entsprechende Geldpolitik erfolgt keine optimale Auslastung der Ökonomie. Ein von den Marktkräften automatisch hergestelltes Gleichgewicht gibt es nicht und kann daher gar kein Thema sein. Nur eine restriktive Geldpolitik kann eine Inflation aufhalten und nur eine expansive Geld- und Finanzpolitik können eine Depression beenden.
Die Postkeynesianer wie Kaldor, Kalecki und Minsky wollen die Krisen mit der Unsicherheit der Zukunft statt mit der Geldpolitik erklären. Krisen seien keine böse Absicht und nicht geplant und von der Geldpolitik gesteuert, sondern die Folge von unabsehbaren Investitionszyklen, die wegen der prinzipiell unsicheren Zukunft immer wieder in Finanzkrisen enden.
Dazu musste aber die neoklassische These aufgegeben werden, dass die Märkte immer zu einem Gleichgewicht streben. Von Keynes stammt dabei nur die prinzipiell unsichere Zukunft.
Besonders Hyman Minsky ist aktuell mit der Finanzkrise wieder hervorgekramt worden. Nach Minsky wären die Krisen unbeabsichtigte Ergebnisse waghalsiger Finanzierungen und könnten dann auch nur durch Bankrott bereinigt werden. Im deutschen Wiki ist der Schwindel schön zu lesen:
In Minskys Krisentheorie, die auch Charles P. Kindleberger beeinflusste, betreiben die Investoren zu Beginn eines Zyklus zunächst eine abgesicherte Finanzierung; die Einnahmen, die den Investitionen folgen, reichen aus, um die Kredite zurückzuzahlen. Erweist sich das Wirtschaftswachstum als stabil, erscheint eine spekulative Finanzierung rentabel. Die Einnahmen reichen jetzt nur noch aus, um die Zinsen der aufgenommenen Kredite zu bedienen; die Kredite selbst dagegen werden durch neu aufgenommene Kredite ersetzt. Schließlich gehen die Investoren zu einem Schneeballsystem über, einem „Ponzi scheme“ (benannt nach Charles Ponzi). Nun werden sogar zur Finanzierung der Zinslast Kredite aufgenommen, da die Investoren immer noch darauf vertrauen, dass ganz zum Schluss die Einnahmen aus der Investition ausreichen, um allen aufgelaufenen Verpflichtungen genügen zu können. Insgesamt wird die Wirtschaft immer labiler, bis es zu einem Platzen der Spekulationsblase und dem Ausbruch einer Finanzkrise kommt.
Die Frage, womit eine Ökonomie denn nun gehindert würde, ihre bereits finanzierten und real aufgebauten Produktionsanlagen durch Güternachfrage auszulasten, bleibt bei Minsky unbeantwortet. Dass zur Linderung der Finanzierung und ihrer Zinslast etwas Inflation hilfreich sein könnte, ist kein Thema.
Minsky hat in Wahrheit die Thesen der Austrian Economics täuschend umformuliert, keynesianisch maskiert und an die Stelle mangelnder Ersparnisse waghalsige Finanzierungen gesetzt. Die Große Depression war jedoch ganz eindeutig durch restriktive Geldpolitik verursacht und endete mit deren Aufgabe, wie wir wissen.
Die Hubschraubertheorie des Monetarismus von Milton Friedman
Die „Fachpresse“ bejubelte 1969 eine Kindergeschichte von Milton Friedman (The Optimum Quantity of Money):
Eine Gemeinschaft von Bürgern tausche ihre produzierten Güter und gebrauche dabei 1000 Zettel mit dem Aufdruck „Dies ist ein Dollar“, wobei das Leihen oder Borgen wirksam verboten sei, so dass der Austausch von Gütern nur mit diesen Zetteln abgewickelt werden könne. Empirische Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Geldmenge und Jahreseinkommen hätten ein Verhältnis von 1/10 ergeben, daher könne man für diese Gemeinschaft ein Gesamteinkommen von 10 000 Dollar annehmen:
Let us suppose now that one day a helicopter flies over this community and drops an additional $1000 in bills from the sky… (Friedman 1969, S. 4-5)
Jedes Individuum soll genau so viel Geld aufsammeln, wie es vorher hatte, so dass also die Geldmenge bei jedem verdoppelt wird. Wie wird sich diese Verdopplung der Geldmenge auswirken, wenn sich weiter in dieser Gemeinschaft nichts geändert habe? Friedman behauptete, dass die Preise sich entsprechend der Geldmenge verdoppeln müssten, weil die Leute alle versuchen würden, jetzt mit der doppelten Geldmenge zu kaufen. Die reale Menge der Güter sei aber nicht gestiegen, so dass sich deren Preise verdoppeln müssten. Derartige Argumente für seine Quantitätstheorie des Geldes brachten Milton Friedman 1976 den Nobelpreis ein.
Der Trick ist leicht entlarvt: Es gibt in seiner Zettelwirtschaft kein richtiges Geld, weil ein richtiges Geld eben Schuldgeld ist und Leihen wie Borgen erlaubt sein muss. Die Gemeinschaft in seiner Geschichte hätte bei einem Jahreseinkommen von 10.000 Dollar etwa 30.000 Dollar an Geldvermögen und Schulden. Würden die aufgesammelten 1000 Dollar auf Schuldner und Sparer gleichmäßig aufgeteilt, erhielten diese je 500 Dollar und würden das gefundene Geld, um ihre Kassenhaltung nicht zu verändern, bei ihrer Bank einzahlen; die schickt es an die Zentralbank und weg ist es. Die Sparer hätten jetzt 30.500 Dollar Guthaben, die privaten Schuldner kommen auf 29.500 Dollar Schulden und die fehlenden 1000 Dollar Schulden hat Milton Friedman mit seinem Hubschrauber (Staat).
Falls die Ökonomie unterausgelastet war, dann würde diese Geldverteilung durch den Staat die Geschäfte etwas anregen, in einem Boom würde es sicher auch zu leichten Preissteigerungen kommen. Die Keynesianerin Joan Robinson hatte in ihrem Büchlein „Ökonomische Theorie als Ideologie“ zu Milton Friedman diesbezüglich nur eine kurze Anmerkung:
In Friedmans Gedanken findet sich ein überirdisches, mystisches Element. Die bloße Existenz eines Geldbestandes ruft irgendwie Ausgaben hervor. Soweit er jedoch eine verständlich Theorie anbietet, besteht sie aus von Keynes entlehnten Einzelteilen. (Joan Robinson 1974, S. 83)
Zur Bestärkung seiner Theorie hat Milton Friedman sogar die Große Depression monetär erklärt: Die US-Notenbank habe von 1929 bis 1933 die Geldmenge zu stark reduziert. Das wäre nicht Absicht und logische Konsequenz des Goldstandards gewesen, sondern in Unkenntnis der richtigen Geldmengenpolitik geschehen, die ein stetiges Wachstum der Geldmenge anstreben solle. Diese Erklärung widerspricht der sonst immer betonten Neutralität des Geldes in der Quantitätstheorie, in der Geldmengenänderungen sich ja nur auf die Preise auswirken sollen.
Die Schwankungen von Geldmengen sind die Folgen ökonomischer Konjunkturschwankungen, nicht deren Ursachen, wie die Monetaristen behaupten. Die breite Bevölkerung kann nicht wissen, dass eine direkte Steuerung von Geldmengen nicht möglich ist und die Notenbank Krise oder Boom verursachen muss, um die Geldmengen entsprechend sinken oder steigen zu lassen. Die Verursachung von Krisen durch die Notenbank würden die Bürger empört ablehnen, also wurde von den Monetaristen behauptet, dass die Notenbank doch nur die Geldmenge steuern sollte.
In den 70er Jahren wurden die neoliberalen Anhänger des Monetarismus an Universitäten und in der Politik, in den Notenbanken wie in den Massenmedien in Stellung gebracht und 50 Jahre nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise war es dann wieder so weit, dass die Geldpolitik Krise und Massenarbeitslosigkeit unter dem Vorwand der Geldmengensteuerung zur Inflationsbekämpfung erzeugen konnte.
Die Theorie realer Konjunkturzyklen zur Volcker Rezession
Auf dem Höhepunkt der von dem damaligen FED-Chef Paul Volcker mit brutaler Hochzinspolitik (20% für FED-Geld) inszenierten Weltrezession wurde 1982 im Journal of Monetary Economics die Real-Business-Cycle-Theorie (RBC-Theorie) dem Publikum vorgestellt.
Deren Urheber Edward C. Prescott und Finn E. Kydland behaupteten, dass Rezessionen und Konjunkturzyklen keine monetären, sondern reale Ursachen hätten. Neue Technologien würden schubweise und schockartig auftreten und einen Anpassungsprozess der Wirtschaft erzwingen. Im Jahr 2004 haben die beiden Figuren für ihren Schwindel den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis erhalten.
Über die Geldpolitik behaupteten die beiden Professoren angesichts der verheerenden Rezession, dass Konjunkturverläufe umso stabiler wären, je glaubwürdiger Notenbank und Politik ihren Kurs durchhalten würden.
Die These, dass Massenarbeitslosigkeit und Krisen technologisch bedingt wären, wurde schon von Ricardo anlässlich der seinerzeit auf seinen Rat mit restriktiver Geldpolitik angerichteten Verheerungen vorgetragen. Er hatte früher in seinen Schriften derartigen Unsinn noch selber abgelehnt, aber gegen Ende der Deflationspolitik im Jahr 1821 kam ihm die Theorie einer von Rationalisierung und technischem Fortschritt verursachten Massenarbeitslosigkeit sehr gelegen. Ein Jahrhundert später widersprach Knut Wicksell Ricardos Argumenten. Man lese dazu:
Thomas M. Humphrey: Ricardo versus Wicksell on Job Losses and Technological Change
Reversing his original position that innovation benefits all, Ricardo in 1821 constructed his model to demonstrate that workers have much to fear from technical change.
“All I wish to prove,” he said, “is, that the discovery and use of machinery may be attended with a diminution of gross produce: and whenever that is the case, it will be injurious to the labouring class, as some of their number will be thrown out of employment, and population will become redundant, compared with the funds which are to employ it”. (S. 6)
Das absurde Argument Ricardos war also, dass der Kauf von Maschinen den angeblichen Lohnfond für die Beschäftigung von Arbeitern verringern und damit sogar die Gesamtproduktion der Ökonomie senken würde.
Almost one hundred years later, Knut Wicksell deployed essentially the same model, albeit with a different assumed coefficient of elasticity of labor supply and a different theory of labor demand, to argue that Ricardo’s predictions were flawed and that jobs and real output need not be lost to technological progress. (S. 6)
Die Lucas-Kritik
Ein beliebtes Argument gegen keynesianische Konjunkturpolitik ist die sogenannte Lucas-Kritik. Sie besteht in der Behauptung, dass Konjunkturpolitik unwirksam wäre, weil sich unter der Annahme "rationaler Erwartungen" die ökonomischen Zusammenhänge durch die Wirtschaftspolitik ändern.
Z.B. würde eine höhere Inflation nicht zu mehr Beschäftigung führen, sondern einfach zu noch stärker steigenden Löhnen und Preisen. Auch hier haben wir es wieder mit einem einfachen Zirkelschluss zu tun, der darauf beruht, die Makroökonomie nach Keynes halt nicht verstehen zu wollen:
Lucas und Konsorten unterstellen nämlich, dass eine expansive Geldpolitik nur dadurch auf die Beschäftigung wirke, dass den Arbeitern ein höherer Reallohn vorgetäuscht werde. Das Konzept der Lucas-Kritik beruht wieder auf der angeblich freiwilligen Arbeitslosigkeit, von der die Arbeiter nur durch eine Vortäuschung höherer Löhne abzubrinmgen wären. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil die expansive Geldpolitik nach Keynes ja dadurch wirkt, dass sie das Sparen von Geld entmutigt und den Realzins senkt und dadurch für mehr Güternachfrage und Beschäftigung sorgt.
Außerdem ist die Wirtschaftsgeschichte reich an Beweisen für die Wirksamkeit expansiver Geld- und Finanzpolitik. Aber die Geschichte darf ja im VWL-Modellbau nicht beachtet werden und zählt nicht als Argument. Oder sie wird frech bestritten und geleugnet, wie etwa durch Ed Prescott, den Erfinder der Real Business Cycle theory:
“It is an established scientific fact that monetary policy has had virtually no effect on output and employment in the U.S. since the formation of the Fed,” Professor Prescott, also on the faculty of Arizona State University, wrote in an email. Bond buying [by the Fed], he wrote, “is as effective in bringing prosperity as rain dancing is in bringing rain.”
Noah Smith: The Econ Nobel Prize is really weird
Das Ricardianische Äquivalenztheorem
Mit dem Ricardianischen Äquivalenztheorem wollten die Professoren beweisen, dass eine Belebung der Konjunktur durch höhere Staatsausgaben oder Steuersenkungen nicht möglich sei. Der Grund wäre, dass die Haushalte wegen des höheren Staatsdefizits mit entsprechend höheren Steuern in der Zukunft rechnen müssten und sofort ihre Sparquote erhöhen, um für die erwarteten Steuern zusätzliche Ersparnisse zu bilden. Die höheren Staatsausgaben würden also durch das verstärkte Sparen der Haushalte in ihrer Wirkung auf die Konjunktur wieder neutralisiert und die Professoren glaubten, damit bewiesen zu haben, dass eine Ankurbelung der Konjunktur gar nicht möglich sei.
Tatsächlich beweist das Ricardianische Äquivalenztheorem die bodenlose Dummheit der Professoren: Nach der Saldenmechanik bewirkt ein höheres Defizit des Staates ganz automatisch eine um genau den
gleichen Betrag höhere Ersparnis der Privaten (Haushalte und Unternehmen). Zusätzlich steigen die Einkommen der Haushalte um das Produkt des Defizits und des Multiplikators von Keynes. Die
zusätzliche Verschuldung des Staates bewirkt also völlig ohne ein zusätzliches Sparen der Haushalte die höhere Ersparnis bei noch mehr erhöhten Einkommen.
Würden die Haushalte dagegen ihre Sparquote erhöhen, dann würde ihre Ersparnis überhaupt nicht steigen, sondern nach dem Sparparadoxon würde nur das Einkommen der Haushalte entsprechend sinken. Damit wäre zwar die vom Staat gewünschte Belebung der Konjunktur tatsächlich gescheitert, aber die Haushalte müssten nicht nur von der unbegründeten Erwartung ausgehen, dass der Staat seine Defizite in Zukunft tilgt, zusätzlich müssten die angeblich nach rationalen Erwartungen handelnden Haushalte eine völlig falsche Vorstellung der makroökonomischen Zusammenhänge haben und mit der höheren Sparquote ihre Einkommen senken.
Die Neue Keynesianische Makroökonomie ist eine dreiste Verfälschung von Keynes
Weil die Erkenntnisse von Keynes nicht zu widerlegen waren, hat sich die herrschende Lehre seit 1936 darauf verlegt, die Lehre von Keynes frech zu verfälschen. Dabei wird von den Professoren ein allen Erkenntnissen von Keynes widersprechendes Modell als "keynesianisches Modell" oder gar "Neue Keynesianische Makroökonomie" bezeichnet.
Für den Laien und sogar für die VWL-Studenten ist es immer schwer verständlich, dass Keynesianer gegen die "Neue Keynesianische Makroökonomie" argumentieren. Der Grund dafür ist, dass die "Neue Keynesianische Makroökonomie" nichts als ein dreckiger Betrug durch die Gegner von Keynes in der VWL ist. Ja, es ist nichts als Betrug und Lüge und Frechheit der Vertreter der herrschenden Lehre in der VWL heute, ihren den Erkenntnissen von Keynes direkt widersprechenden Unsinn als "Neue Keynesianische Makroökonomie" zu bezeichnen.
Die NKM gehört zu den sogenannten „neuen makroökonomischen Modellen“ auf mikroökonomischer(!) Grundlage. So etwas überhaupt als „Keynesianische Makroökonomie“ zu bezeichnen, ist schon eine Frechheit! Der angebliche „Keynes“ an diesem Modell besteht in einer Rigidität der Löhne und Preise, die sich nur verzögert an die Marktsituation anpassen, was zwar von Keynes irgendwo in seiner Allgemeinen Theorie diskutiert wurde, aber eben nicht als die Ursache der Krisen, was die VWL-Professoren sicher auch gelesen haben müssen.
Die makroökonomischen Gesetze sollen in der NKM aus den mikroökonomischen Nutzenkalkülen der Haushalte und Unternehmen hergeleitet werden. Es handelt sich also eben nicht um makroökonomische Zusammenhänge, die da betrachtet werden, sondern um falsche Schlüsse aus mikroökonomischen Vorstellungen auf die Makroebene. Zur Täuschung des Publikums wird das dann auch noch nach Keynes benannt, für den dieser Ansatz eine einzige gigantische Dummheit gewesen wäre.
Im Zusammenhang mit der NKM wird der alte Schwindel von Hicks und Samuelson als „Alte Keynesianische Makroökonomie“ (OKM) bezeichnet.
DSGE-Modellbau
Es handelt sich bei der NKM um ein sogenanntes DSGE-Modell (dynamic stochastic general equilibrium): Es werden Gleichgewichtskurven über eine Y-Achse gemalt, die sich an der Wand oder Tafel im „allgemeinen Gleichgewicht“ schneiden. Diese Kurven enthalten Planungen und Erwartungen der Haushalte und Unternehmen zur Nutzenmaximierung für die Zukunft und benötigen das halbe griechische Alphabet für ihre mathematischen Formeln. Die Studenten werden mit möglichst komplizierter Mathematik zur Kurvenberechnung statt mit den makroökonomischen Zusammenhängen beschäftigt.
Die Preise sollen „sticky“ sein, also sich nicht einfach ändern lassen, und die Löhne bleiben unter der Grenzproduktivität, weil die monopolistischen Firmen sich Extraprofite verschaffen können. Sonst das übliche Hicks-Samuelson-IS-LM-Zeug in einem vervielfachten Formelwust.
Es gibt zusätzlich „sticky-information“ und alle Beteiligten gehen von eher falschen Informationen und nur verzögert angepassten Erwartungen für die Zukunft aus, was zwar richtig ist, aber von den wirklichen Problemen der Makroökonomie und der grundsätzlichen Unbrauchbarkeit des IS-LM-Modells ablenken soll. Die Große Depression entstand eben nicht wegen rigider Preise und Löhne oder wegen falscher Informationen und Erwartungen, sondern weil die Geldpolitik sie ganz gezielt geplant und betrieben hatte und weil korrupte VWL-Professoren eine krisenverschärfende Deflationspolitik propagiert haben.
Arbeitslosigkeit als freiwillige Nutzenmaximierung
Wie es Lars P. Syll hier beschrieben hat, erklären die DSGE-Modelle die Arbeitslosigkeit mit der freien Entscheidung der Arbeiter, zum Beispiel wegen der in der Great Depression 1929-33 stark gefallenen Löhne, lieber nichts arbeiten zu wollen: In DSGE models the unemployed are happier than the employed
Lachen Sie jetzt nicht, das ist der volle Ernst dieser VWL-Professoren, dass die Arbeiter langfristig nur ihren Nutzen maximieren und darum in den Zeiten der Krise aus ganz freiem Willen daheim bleiben, statt weiter ihre Arbeit auszuüben. Das müssen die Studenten dann als Erkenntnis der "Neuen Keynesianischen Makroökonomie" lernen!
Warum jede Geld- und Konjunkturpolitik wirkungslos wäre
Der vorgebliche Beweis für die gewagte These, dass Geld- und Konjunkturpolitik nutzlos sei, ist wieder ein Zirkelschluss: Man geht in den DSGE-Modellen davon aus, dass Unternehmen wie Konsumenten ihren Gewinn und Nutzen maximieren und dabei die Zukunft genau vorhersehen können. Vor allem können sie die Zukunft völlig richtig vorhersehen, woraus dann folgt, dass sich an dieser richtigen Vorhersicht auch durch die Geld- und Konjunkturpolitik nichts ändern lässt. Denn könnte die Konjunktur doch mit der Geld- und Finanzpolitik beeinflusst werden, widerspräche dies ja der richtigen Vorhersicht durch Unternehmen und Haushalte.
Warum nur eine völlig überraschende Geld- und Finanzpolitik wirksam wäre
Das Argument ist eine Abschwächung der angeblichen Wirkungslosigkeit, beruht aber auf demselben Zirkelschluss: Man gesteht jetzt ein, dass die Voraussicht der Zukunft bei Unternehmen und Haushalten nicht immer perfekt sein kann. Also wäre Konjunkturpolitik möglich. Aber nur, wenn sie die Unternehmen und Haushalte völlig überrascht, also nicht eine keynesianische Konjunkturpolitik ist, die halt die Zinsen senkt und mit Staatsverschuldung die Krise beenden will. Denn eine keynesianische Politik würde ja von den ihre Zukunft planenden Unternehmen und Haushalten perfekt vorhergesehen und wäre damit wieder wirkungslos. Es darf gelacht werden.
Warum es doch Krisen gibt trotz perfekter Planung der Zukunft
Auf die Antwort der Vertreter der DSGE-Modelle müssen Sie wohl noch lange warten.
Der Neue Keynesianer Gregory Mankiw
Gregory Mankiw war unter George W. Bush von 2003 bis 2005 Chef-Wirtschaftsberater der US-Regierung. Dass ausgerechnet Mankiw sich als Vertreter einer New Keynesian Economics ausgibt, ist offensichtlicher Betrug und Dummenfang, was Mankiw selbst gar nicht verheimlicht:
One might suppose that reading Keynes is an important part of Keynesian theorizing. In fact quite the opposite is the fact. […] If new Keynesian economics is not a true representation of Keynes’ views, then so much the worse for Keynes. The General Theory is an obscure book. […] [it] is an outdated book. […] We are in a much better position than Keynes to figure out how the economy works. […] Classical theory is right in the long run. Moreover, economists today are more interested in the long-run equilibrium. The long run is not so far away.
Gregory Mankiw: The Reincarnation of Keynesian Economics (1992), S. 560–561
Gregory Mankiw besitzt also die Frechheit, sich zur Täuschung der Studenten und des Publikums als Neuer Keynesianer zu verkleiden und als solcher die von Keynes vertretenen Ansichten für falsch, die Lektüre der Schriften von Keynes für unnötig und die Allgemeine Theorie für obscur zu erklären. Er bekennt sich zu den Dogmen der Klassiker und verwirrt seine Studenten, indem er mit seinem Auftreten den Eindruck erweckt, dass Keynesianer seit neuestem gegen Konjunkturpolitik wären, das Geld wieder für neutral hielten und die Ursache der Arbeitslosigkeit in der Weigerung der Arbeiter sehen würden, für einen den Arbeitsmarkt räumenden Lohn zu arbeiten. Seine oben zitierten Aussagen belegen die ganze Schamlosigkeit der Ökonomenzunft an unseren Universitäten.
Lars P. Syll über Mankiw und Krugman:
Der nun wirklich echte Keynesianer Lars P. Syll, den man nicht genug loben kann, hält auch Krugman für keinen wirklichen Keynesianer:
“New Keynesianism” is a gross misnomer. The macroeconomics of people like Greg Mankiw and Paul Krugman has theoretically and methodologically a lot to do with Milton Friedman, Robert Lucas and Thomas Sargent — and very little, or next to nothing, to do with the founder of macroeconomics, John Maynard Keynes.
Why “New Keynesianism” is such a gross misnomer
Die Modern Monetary Theory (MMT)
Das "moderne" dieser monetären Theorie besteht darin, dass die Professoren endlich lehren dürfen, dass durch die Kreditvergabe der Banken tatsächlich eine Geldschöpfung erfolgt und damit die Güternachfrage steigt oder eben bei restriktiver Kreditpolitik sinkt. Dass daher das Bankensystem die Krisen inszeniert, dürfen die Vertreter der MMT aber nicht vertreten. Sie erklären die Krisen statt mit der Absicht der Finanzoligarchen mit der seit Keynes strapazierten Unsicherheit, also mit Hyman Minsky, der dann entsprechend als großer Denker angepriesen werden muss. Ich hätte über das Thema MMT ja lieber höflich geschwiegen, aber dann glaubt noch jemand, es gäbe einen Lichtblick in der VWL, weil Professoren nicht mehr behaupten, dass Geld völlig neutral sei und von den Banken nur zuvor Erspartes verliehen würde.
Die führenden Vertreter der MMT dürfen bei Soros auftreten, wie etwa Steve Keen mit seinem Papier auf der Berliner Konferenz von INET. Auf dieser Konferenz wurden dem Publikum von Joschka Fischer bis Norbert Walter alle Zumutungen geboten und einige Beobachter haben vorgeschlagen, das "N" für "New" aus dem Namen des Instituts von Soros zu streichen. Das Papier von Steve Keen, nach dem die Banken durch ihre Kreditschöpfung die Krise ausgelöst hätten, diskutiert einen Ausweg aus den Krisen allen Ernstes durch Schuldenerlasse nach dem Vorbild der jüdischen Jubeljahre, da könnten die Spekulanten jubeln und mit den scharf fallenden oder wieder steigenden Kursen der Anleihen spekulieren. Das ferne Licht ist nicht das Ende des Tunnels, sondern nur der Soros mit seinen Leuten.
Die Debatten sind weitgehend Schattengefechte, wie etwa, wenn Steve Keen dem Bernanke vorwirft, die Weltwirtschaftskrise nicht richtig analysiert zu haben, weil er nur Irving Fisher nacherzählt und eben den großen Hyman Minsky mit seiner Hypothese der grundsätzlichen Finanzinstabilität unterschlagen habe.
Die Wachstumstheorien
Vermutlich hat es noch kein Student gewagt, seinen Professor zu fragen, was der eigentlich ständig mit dem blöden Gleichgewicht will: Dafür kann man sich nichts kaufen und wenn alle verhungert sind, befindet sich die Ökonomie für immer im Gleichgewicht. Trotzdem kam den Ökonomen einmal eine gute Idee, sich mit dem Problem des Wachstums zu beschäftigen, wie es also möglich ist, den allgemeinen Wohlstand durch Wirtschaftswachstum zu steigern.
Die Idee war gut, die Umsetzung aber den üblichen Methoden der Ökonomen entsprechend. Das Harrod-Domar-Modell von 1939/46 sah im Wachstum eine Funktion des Kapitalstocks. Es soll also wieder möglichst viel gespart werden, weil dadurch der Kapitalstock wachse. Die Studenten kann man dann damit plagen, das Gleichgewicht von I und S und geeignete Nachfragefunktionen für ein Gleichgewicht zu berechnen, außerdem lässt sich das alles noch mit dem Bevölkerungswachstum verkomplizieren, aber den ganzen mathematischen Quatsch wollen wir uns schenken. Das Modell gilt als "postkeynesianisch", was selbst bei Wiki Verwunderung auslöste, weil es die Wachstumsschwäche mit höheren Ersparnissen, also vor allem mit höheren Profiten zu überwinden empfiehlt - der übliche Schwindel also:
So betrachtet ist das "keynesianische" Modell nicht gewerkschaftsfreundlich.
Vor allem konnte das Modell nicht erklären, warum Kapital nicht aus hoch entwickelten Ländern in unterentwickelte Länder floss, wenn nur der Kapitalmangel das Wachstum bremse und Kapital bei Kapitalmangel höher verzinst werde. Das Lucas-Paradox sollte dies erklären ohne den angeblichen Kapitalmangel zu hinterfragen.
Im Jahr 1956 wurde mit dem Solow-Modell erstmals der Faktor "technischer Fortschritt" eingeführt:
Y = A x f(L,K) mit A = technischer Fortschritt, L = Labour und K = Kapital
Eigentlich wäre die Sache ganz einfach gewesen, dass es halt auf den Faktor A ankommt und uns weder die Änderungen von L noch von K zu interessieren bräuchten. Die VWL hat aber den guten Ansatz gleich zunichte gemacht und wieder Gleichgewichte aus Variationen von L und K berechnet. Ein unbrauchbarer Formelwust, in dem das einzig entscheidende Kriterium unterging, nämlich wie erzielen wir einen möglichst positiven Fortschritt in unserer Ökonomie. Dieser Faktor A ist eben nicht nur rein technisch zu betrachten, es geht nicht nur um Erfindungen wie die Dampfmaschine oder den Computer, viel wichtiger sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen die Menschen trotz Dampfmaschinen und Computer in Armut und Elend gehalten werden, wie ein kurzer Blick auf den Globus beweist. Mit dem Aufkommen der Öko-Bewegung wuchs die Kritik am Solow-Modell, Optimismus hinsichtlich der Technik und der Verbesserungen des Lebensstandards waren in den herrschenden Kreisen nicht mehr gefragt.
Mit dem Romer-Modell im Jahr 1990 wurde der Versuch gemacht, den technischen Fortschritt wieder in den Griff zu kriegen, also diesen gefährlichen Faktor wieder im Sinne von Konsumverzicht und Sparen auszudeuten. Jetzt wird halt nicht mehr zur Vergrößerung des Kapitalstocks gespart und konsumverzichtet, sondern zur Steigerung des Humankapitals und zur Investition in die Forschung. Hauptsache es muss wieder gespart und durch Konsumverzicht investiert werden, jetzt sollen die Leute sich halt den technischen Fortschritt vom Mund absparen und grenzenlos in ihr Humankapital investieren. Weil die Investitionen in Forschung und Humankapital von den Firmen getätigt werden, kommt es wieder auf möglichst hohe Profite und niedrige Löhne zur Förderung des Wachstums an:
Wirtschaftliches Wachstum entsteht im Romer-Modell wie folgt:
1) Konsumverzicht führt über Kapitalakkumulation zu einem Zuwachs an Produktivität und damit zu Wachstum.
2) Bei Konsumverzicht (d.h. bei einer niedrigen Zeitpräferenzrate der Haushalte) kann ein Teil des Humankapitals im Forschungs- statt im Konsumgüterbereich eingesetzt werden. ...
In der sogenannten endogenen Wachstumstheorie wurde dann die Produktionsfunktion noch vereinfacht mit dem AK-Modell:
Y = A x K mit A als Konstante für die Technologie und K für das Kapital einschließlich des Humankapitals
Der schon erwähnte Robert Lucas, ein Neoliberaler der Universität von Chicago, hat dann mit seinem Uzawa-Lucas-Modell wieder die gewohnte Produktionsfunktion benutzt:
Y = f(K,H) mit K = Sachkapital und H = Humankapital
Da konnte man endlich gleich in beide Produktionsfaktoren durch Sparen und Konsumverzicht durch hohe Profite bei niedrigen Löhnen investieren und der bisher undefinierbare Faktor A für technischen Fortschritt und Effizienz war wieder eingesackt. Denn die hohen Profite für die Reichen, die damit fehlende Massenkaufkraft der Bevölkerung und das damit verstärkte Sparen sind wichtig:
Das Sparen ist die Ursache aller Wirtschaftskrisen!
Die VWL-Kritik an den Hochschulen
Inzwischen haben sich einige kritische Gruppen unter den Studenten der VWL gebildet, die mit der herrschenden Lehre nicht einverstanden sind. Wer sich näher dafür interessiert findet unter dem folgenden Link einen guten Überblick der verschiedenen Hochschulgruppen:
Der Pluralismus ist auch nur eine neue Nebelwand für die Studenten. Es würde ja reichen, sich mal mit der Neoklassik kritisch zu beschäftigen und sich zu fragen, wie und wofür die Professoren zu ihrer "wissenschaftlichen" Erkenntnis kommen, dass halt die Löhne zu hoch und die Profite zu niedrig seien, Kapital fehlen würde und mit Lohnkürzung und Sozialabbau erspart werden müsse. Dafür könnte man sich den ganzen Pluralismus sparen, der davon nur ablenken soll.
Der Offene Brief (Göttingen, den 11. September 2012) an den Verein für Socialpolitik enthält einige gute Ansätze, zum Beispiel endlich die Wirtschaftsgeschichte zu studieren, aber auch die üblichen Verwirrspiele und spezielle Probleme:
Der Schwerpunkt der derzeitigen Lehre und Forschung liegt auf Varianten neoklassischer Grundmodelle. Für Forschung und Lehre jenseits dieser Spielarten ist an deutschen Hochschulen zu wenig Platz. Diese „geistige Monokultur“ schränkt die ökonomische Analyse ein und macht sie fehleranfällig. Wir fordern ein kritisches Miteinander unterschiedlicher Theorien. Die Volkswirtschaftslehre ist eine Sozialwissenschaft und muss – wie andere Sozialwissenschaften auch – vielfältige theoretische Ansätze beherbergen. Vielversprechende, aber derzeit weitestgehend vernachlässigte Ansätze sind beispielsweise: Alte Institutionenökonomik, Evolutorische Ökonomik, Feministische Ökonomik, Glücksforschung, Marxistische Ökonomik, Ökologische Ökonomik, Postkeynesianismus und Postwachstumsökonomik.
Ein kritisches Miteinander mit dem Schwindel der Neoklassik? Na ja, vielleicht für "Glücksforscher" und "Postwachstumsökonomen". Es ist selbstverständlich nicht zu vermeiden, dass bei der Gelegenheit alle möglichen Leute mit ihrem Steckenpferd angerannt kommen und denken, jetzt habe die Stunde ihres großen Auftritts geschlagen. Das geht von feministischer und ökologischer Ökonomie über diverse Bastardkeynesianer bis zur marxistischen Krisentheorie im Dienst der Finanzoligarchen. Bei den Marxisten ist Geldpolitik ein verbotenes Thema und Krisen sollen immer wieder davon kommen, dass die Kapitalisten plötzlich nicht genug "lebendige Arbeit" zur Ausbeutung fänden. Das wird absichtlich so umständlich nach der Arbeitswerttheorie von Marx hergeleitet, dass jeder, der es ausdiskutieren und kritisieren wollte, den Rest seines Lebens daran geben müsste und die Geldpolitik währenddessen ganz ungestört schon mit der überübernächsten Finanzkrise fertig ist.
Nur mit dem echten Keynes will sich (fast) niemand beschäftigen, weil die Studenten ja meinen, von ihren VWL-Professoren mit "keynesianischen Modellen" über John Maynard Keynes schon ausreichend informiert worden zu sein.
Die Mathematisierung der Ökonomik hat dazu geführt, dass die Lehre zur angewandten Mathematik verkommen ist. Die Mathematik darf für ÖkonomInnen nur ein Mittel und niemals ein Selbstzweck sein. ... Die Lehrmethoden müssen beispielsweise durch plurale Lehrbücher, Kleingruppenarbeit, Projektseminare, inter- und transdisziplinäre Veranstaltungen, Fallstudien sowie das Studium von Primärtexten erweitert werden.
Richtig, ohne die komplizierten Formeln würden die Studenten den neoklassischen Schwindel auf der Stelle durchschauen und den Professor auslachen. Die hier vorgeschlagenen alternativen Methoden könnten die Studenten allerdings genau so wirksam wie die Mathematisierung verwirren.
Zu oft werden die grundlegenden Annahmen der Volkswirtschaftslehre weder explizit dargelegt noch hinterfragt. Dabei sind diese Annahmen oft nicht nur deskriptiver, sondern auch normativer Natur. Letztendlich wohnen jeder volkswirtschaftlichen Analyse gewisse Werturteile inne. Ihre Reflexion ist ein notwendiger Teil wissenschaftlichen Arbeitens. Besonders die Mathematisierung der Ökonomik führt zu einer Verschleierung der Werturteile und so zu einer vermeintlichen Rationalisierung politischer Programme. ...
Annahmen normativer Natur? Verschleierung der Werturteile? Nein, da werden nicht Werturteile verschleiert und schon gar nicht wird da rationalisiert. Die Neoklassik vernachlässigt nicht die Ethik, sondern die Logik! Die Studenten haben noch nicht realisiert, dass sie mit der zirkulären Herleitung makroökonomischer Dogmen aus den Annahmen der Modelle mittels ausgefeiltester Mathematik ganz einfach zum Narren gehalten werden. Die Studenten meinen immer noch, sie hätten volkswirtschaftliche Zusammenhänge analysiert und dabei normative und moralische Fragen ausgeklammert. Dabei hat man ihnen einfach nur einen üblen Schwindel vorgesetzt und sie haben es nicht einmal durchschaut. Das Normative und die Werturteile kämen erst nach dem Verständnis der wirklichen ökonomischen Zusammenhänge. Wirtschaftsethik gibt es an der Uni seit mindestens dreißig Jahren und außer billigem Gewäsch hat es nichts gebracht. Da sollten wir es endlich mit Logik versuchen und die Ethik den Theologen überlassen, denn ethische Ansprüche zu erfüllen, behaupten die Neoliberalen gerade so, sie sind ja für die unbeschränkte Freiheit des Kapitals.
Des Weiteren müssen Studierende der VWL stärker für die historischen und kulturellen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns sensibilisiert werden. Nur wer sich der Komplexität der Realität bewusst ist, kann wissenschaftliche Modelle richtig anwenden. Nur so besteht keine Gefahr, Modelle mit der Realität zu verwechseln. Hierfür müssen alle ÖkonomInnen die Geschichte ihres Faches und die wissenschaftstheoretischen Grundlagen kennen. Lehrveranstaltungen über die Geschichte des ökonomischen Denkens und Wissenschaftstheorie müssen daher Teil des Curriculums sein.
Die gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns sind wirklich der wichtigste Ansatz zur Überwindung von Armut und Ineffizienz. Nicht Kapitalmangel oder ungenügendes Humankapital beschränken die Produktivität, sondern gesellschaftliche Verhältnisse wie Korruption und systematisches Gegeneinander, also gegenseitiges Blockieren und Schädigen bis zur offenen Kriminalität. Der von der VWL gelehrte Unsinn und der Sachverständigenrat Wirtschaft mit seinen endlosen Forderungen nach Lohnsenkung und Sozialabbau und seinem Eintreten für den Riester- und Rürup-Rentenraub im Interesse privater Finanzer zeigen, wie weit die Korruption von Politik und Gesellschaft unter dem Einfluss des Neoliberalismus auch in unserem Land schon gediehen ist.
Literaturhinweise und Links zu kritischen Arbeiten an den Universitäten:
Eine Initiative französischer Studenten:
We, students in economics from various horizons, would like to express once again our discontent with the way Economics is taught in universities and other academic institutions. For more than ten years now similar initiatives have been continuously publicized in several countries all around the world with no movement on the issue, thus underlining the pervasive nature of the problem and the on-going dismay with the lack of necessary change.
By choosing economics as our major we hoped to gain a better understanding of real economic mechanisms. We are saddened to recognize that this has not been the case at all: the most striking example of it being our incapacity to apprehend the current economic crisis with the analytic tools that we are taught. Far from making up for these flagrant loopholes, courses across the world have stubbornly remained almost the same. The crisis is not only one of the economy, it is also a crisis of economics and a crisis of our classrooms!
Stephan Schulmeister Austrian
Institute of Economic Research (WIFO)
Schulmeister ist der beste Kritiker des Finanzkapitalismus, den man an einer Universität findet, allerdings aus genau diesem Grund höchstens mal als Gastprofessor.
Zur CDS-Spekulation oder Die Freiheit, Teller zu waschen
Erik S. Reinert [The Other Canon Foundation, Norway]: Neo-classical economics: A trail of economic destruction since the 1970s (PDF)
The Other Canon Foundation: Papers
Real-World Economics Review BLOG
Zum Abschluss ein Zitat von David Hume:
Es muss in der Tat zugegeben werden, dass die Natur der Menschheit gegenüber so freigebig ist, dass dann, wenn alle ihre Gaben gleichmäßig verteilt und durch Geschicklichkeit und Fleiß vervollkommnet würden, jeder einzelne alle Notwendigkeiten und sogar die meisten Annehmlichkeiten des Lebens genießen könnte; auch würde der Mensch niemals anderen Leiden unterworfen sein als denjenigen, die sich gelegentlich aus der kränklichen Anlage und der Konstitution seines Körpers ergeben. Ebenso muss zugestanden werden, dass immer dort, wo von dieser Gleichheit abgegangen wird, wir den Armen mehr an Bedürfnisbefriedigung rauben, als wir den Reichen hinzufügen, und dass der törichte Genuss einer frivolen Eitelkeit eines einzigen Individuums häufig mehr kostet als das Brot vieler Familien, ja ganzer Landstriche.
 Hintergründe der Geldpolitik
Hintergründe der Geldpolitik